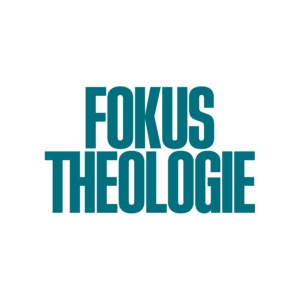1. Der Evangelische Theologiekurs – Geschichtliche Grundimpulse
1.1 Teilhabe aller Gläubigen in der Kirche
Seit vierzig Jahren wird an vielen Orten der Deutschschweiz der Evangelische Theologiekurs angeboten. Wo Jubiläen gefeiert werden, darf man in der Regel davon ausgehen, dass die Dankbarkeit überwiegt. Wofür? In unserer Beschäftigung mit der Geschichte wurde zunehmend klar, dass wir den Evangelischen Theologiekurs einer glücklichen Konstellation verdanken.
Als der Theologiekurs den 1980er Jahren begann, habe die Idee in der Luft gelegen, sagen viele Zeitzeug:innen. Es gab eine wachsende Nachfrage in der Kirche, nach Bildungsangeboten für Erwachsene, nicht zuletzt auch nach theologischer Bildung. Das ist keine Naturkonstante – eine solche Nachfrage kann auch äusserst gering werden, wie wir im Laufe der Zeit selbst an den theologischen Fakultäten lernen mussten. Warum war sie damals so stark?
Es gab in den Gemeinden und in der Kirche eine grosse Sehnsucht nach Teilhabe, nach Partizipation. Menschen wollten mitreden, auch in der Kirche. Anfang der 80er Jahre gab es z.B. in Zürich im Vorfeld des 500. Geburtstages von Zwingli eine Bewegung, die nicht nur an Disputationen von vor 500 Jahren erinnert werden wollte. Viele wollten hier und heute über die eigene Zukunft disputieren. Wer die Berichtsbände zur Zürcher Disputation 1984 durchliest, findet auf jeder Seite Spuren davon, dass Menschen sagten: Wir wollen nicht nur Mitglieder der Kirche sein, wir wollen auch nicht nur Gremien machen lassen, wir wollen beteiligt werden, ständig und nicht nur alle paar Jahre bei den Wahlen von Pfarrpersonen oder der Kirchenpflege.
Theologie wurde als Fachwissen, teils auch als Herrschaftswissen erlebt. Es waren theologische Diskurse, die vermeintlich Gültiges festschrieben. An diesen Diskursen wollten die Menschen ebenfalls teilhaben. Es gab über 400 Anträge, die diskutiert wurden.
Ein Antrag forderte «Förderung und Unterstützung von Bibelkursen und Seminaren. Förderung von Theologischen Kursen für Erwachsene und von weiteren Angeboten, um miteinander über den Glauben zu reden, gemeinsam zu suchen, zusammen im Glauben zu wachsen und damit Anregung zum selbständigem Weiterschaffen zu erhalten. (Einstimmig gutgeheissen)» (Zürcher Disputation, 35)
Es waren solche Stimmungen an der Basis, auf die hin der Theologiekurs entwickelt wurde.
1.2 Kritische Emanzipation
Es gab in dieser Zeit auch eine Sehnsucht, sich mit dem eigenen Glauben und der Kirche kritisch auseinanderzusetzen. Für viele Menschen war der Glaube kein unproblematisches Geschenk. Er wurde als Mitgift früherer Generationen empfunden, als Gabe, die aber auch ihre giftigen Seiten haben konnte. Theologie stand für die Möglichkeit einer Befreiung von Gedanken und Prägungen, die unfrei gemacht hatten.
Für viele Theologiekurs-Teilnehmende war der Theologiekurs Hilfsmittel einer kritischen Aufarbeitung der eigenen Prägung.
«Die Frömmigkeit, die ich von meinen Eltern mitbekommen habe, kann ich nicht auf den Misthaufen werfen, kann und will ich aber so nicht an meine Kinder weitergeben.» (Kaleidoskop, 38)
Und sie empfanden die Theologie als Hilfe gegenüber einer Glaubensgestalt, die für sie mindestens ambivalent geworden war. Aus heutiger Sicht kann man folgendes unterscheiden: Viele suchten keine Destruktion ihres Glaubens, keine Zerstörung, wohl aber eine Rekonstruktion, eine Erneuerung. Und dazu gehört auch ein Prozess der kritischen Auseinandersetzung mit Glaubensformen, die als nicht mehr tragfähig erlebt wurden.
Besonders hilfreich war für die viele die Auseinandersetzung mit der Bibel mit Hilfe der historischen Bibelwissenschaften. Bis heute spielt diese Auseinandersetzung eine zentrale Rolle im Theologiekurs. Was lässt sich dabei lernen?
Historisierung
Zuerst einmal machten viele die Erfahrung: Was ein Text bedeutet, steht nicht einfach schon fest. Es wird nicht festgelegt auf der Kanzel oder von Amtspersonen. Es ist erst einmal eine offene Frage. Was hat der Text damals bedeuten können, für seine Verfasser und Erstleser:innen? Wer so fragt, steht am Beginn einer spannenden Reise. Für die meisten war und ist es eine faszinierende Entdeckung, dass biblische Texte ganz neu lebendig werden, wenn ihr Verständnis sich in einer Entdeckungsreise in die Vergangenheit neu erschliesst.
Pluralisierung
Es gibt zu vielen Fragen unterschiedliche Interpretationen. Am Buch Hiob lässt sich das besonders eindrücklich lernen. Die Frage nach dem Leiden und der Gerechtigkeit Gottes ist keine Bibelfrage, sondern eine Menschheitsfrage. Alle religiösen Strömungen der Menschheit ringen damit. Das Buch Hiob präsentiert ein breites Spektrum von Lösungsansätzen: Ergebung unter den Willen Gottes oder Aufruhr und Protest, Verständnis des Leidens als Folge falscher Wege oder als Mittel zur Reifung, schliesslich auch die Einsicht, das Gottes Wege geheimnisvoll bleiben mögen. Diese Ansätze stehen im Gespräch miteinander.
So gibt es auch im Neuen Testament sehr unterschiedliche Perspektiven auf Jesus Christus, ohne dass versucht wurde, die Vielfalt zu vereindeutigen. Wer die Bibel in ihrer Vielfalt lesen lernt, begreift: Hier werde ich nicht auf eine Linie gezwungen. Hier tut sich ein weiter Raum auf, in dem vielleicht auch ich meinen Platz finden kann.
Kontextualisierung
Schon in der Bibel lässt sich beobachten, wie stark sich Glaube und Theologie mit den geschichtlichen Umständen wandeln. Eine Stammesgruppe hat ganz andere Gottesbilder als ein Volk im Zeitalter grosser Imperien. Wer die biblischen Texte in ihrem eigenen Kontext verstehen lernt, begreift: Der Sinn dieser Texte muss auch in unserem Kontext neu erschlossen werden.
1.3 Erfahrungsnahe Theologie
Es ist schliesslich auch eine Sehnsucht nach Beheimatung. Theologie ist kritisch und muss es sein; wenn sie aber nur kritisch ist, ist Selbstauflösung ihr bester Verlauf. Ja zu einer kritischen Theologie, aber Theologie leistet mehr: Sie macht vertraut mit dem eigenen Glauben. Mit seinen Grundlagen, den biblischen Texten, den grossen Überzeugungen des Glaubens, den vielschichtigen Aspekten, wie man nach der Gerechtigkeit des Reiches Gottes auch in einer globalisierten Welt trachten kann. Im Rückblick auf den Theologiekurs sagt ein Teilnehmender:
«Das Leben und vermutlich auch das Evangelium ist spannender, als mir dies (bisher) in der Kirche begegnet ist.» (Kaleidoskop, 39)
Vor allem die theologisch-didaktischen Überlegungen von Volker Weymann erwiesen sich für die Gestaltung des Theologiekurses als hilfreich. In seiner von Gerhard Ebeling geprägten Theologie legte Weymann Wert auf die Einsicht, dass Glaube immer in Erfahrungszusammenhängen entsteht. Die biblischen Texte sind selbst Niederschlag vieler Lebens- und Gotteserfahrungen. Christliche Inhalte können heute nicht abstrakt weitergegeben werden, wenn sie nicht bezogen sind auf die heutigen Lebenserfahrungen der Menschen.
Teilhabe, Kritik und Beheimatung, ich glaube, dass diese Sehsüchte bis heute entscheidend geblieben sind dafür, dass Menschen ein solch anspruchsvolles Format wie den ETK wagen. Manche sind sehr stark von einem dieser Aspekte angetrieben, viele wohl auch durch eine Mischung.
2. Zukunftsperspektiven
Wie geht es weiter mit dem Evangelischen Theologiekurs? Im Moment besuchen ca. 170 Teilnehmende an zehn Orten in der Schweiz eine Kursgruppe. Die meisten Kurse sind gut ausgelastet und die Nachfrage ist stabil bzw. in jüngster Zeit wieder leicht gestiegen. Wenn wir den Rückblick ernstnehmen, ist natürlich klar, dass es nicht immer so weiter gehen kann. Auch der Theologiekurs steht im Wandel der Zeit.
2.1 Erwachsene Theologie
Dass erwachsene Menschen nicht nur religiös bzw. gläubig sind, sondern selbst Theologie treibende Subjekte, diese Einsicht dürfte sich ruhig noch etwas stärker durchsetzen. In diesem Sinne sprechen wir von erwachsener Theologie.
Ein Blick in die grundlegenden Lehrbücher der Religionspädagogik macht schnell klar, dass es sich bei der Erwachsenenbildung um eine merkwürdige Mischung aus Stiefkind und Science Fiction handelt. Bei Friedrich Schweitzers Religionspädagogik (2006) zeigt schon das Inhaltsverzeichnis, dass sich sehr viel sagen lässt zur Religionspädagogik des Kinder- und des Jugendalters; und eher wenig zur Frage der Erwachsenenbildung. Das hat Schweitzer auch selbst bemerkt, so dass er den Abschnitt mit den Worten beginnt:
«Wenn dieser Abschnitt zum Erwachsenenalter vergleichsweise kürzer ausfällt als die zum Kindes- und Jugendalter, so soll darin keineswegs eine Geringschätzung zum Ausdruck kommen. Vielmehr gilt umgekehrt: Die Vernachlässigung von (religiöser) Bildung im Erwachsenenalter ist zu überwinden zugunsten einer systematischen Wahrnehmung dieses Bereichs als eines genuinen Bestandteils von Religionspädagogik und kirchlicher Bildungsarbeit.» (Schweitzer 2006, 252f.)
Mehr als 10 Jahre später, erscheint 2017 die noch grössere Religionspädagogik von Michael Domsgen. Dass der grössere Umfang nicht darauf zurückzuführen ist, dass das Thema Erwachsenenbildung nun im grossen Stil bearbeitet wird, merkt man schnell im Inhaltsverzeichnis. Das Stichwort Erwachsenenbildung ist nur nach sehr gründlicher Suche auffindbar. Da heisst es dann:
«Was Schweitzer bereits 2006 programmatisch forderte, nämlich die ‘Vernachlässigung von (religiöser) Bildung im Erwachsenenalter (…) zu überwinden zugunsten einer systematischen Wahrnehmung dieses Bereichs als eines genuinen Bestandteils von Religionspädagogik und kirchlicher Bildungsarbeit’ gilt uneingeschränkt auch heute.» (Domsgen 2019, 189)
Dass Erwachsene nicht nur religiöse Bildung suchen, sondern ausdrücklich theologische Bildung, gilt nicht als selbstverständlich. Dass Menschen nicht nur religiöse Erfahrungen machen oder religiös – rituelle Begleitung suchen, sondern sich dazu Gedanken machen wollen, das ist langsam klar geworden. Seit einiger Zeit gibt es Bücher zum Thema Theologisieren mit Kindern. Naja, dass man einen solchen Ansatz irgendwann ausweitet auf Theologisieren mit Erwachsenen erscheint logisch.
Denn es ist eine problematische Logik, den Menschen zwar religiöse Erfahrungen zuzuschreiben, die Reflexion der Religion aber mit der wissenschaftlichen Theologie an den Universitäten gleichzusetzen. Sehr viele Menschen, vielleicht sogar alle, reflektieren was sie glauben.
Das Theologisieren von Erwachsenen ist Theologie im vollen Sinne.
Die wissenschaftliche Theologie ist lediglich eine besonders intensive Form solcher Reflexion in interdisziplinarischer Vielfalt, deren Güte auch danach bemessen werden sollte, inwiefern sie das Theologisieren erwachsener Menschen wahrnehmen, anregen und begleiten kann. Daran hängt nicht zuletzt auch die Zukunft der Kirche, dass die Menschen selbstbewusst und sprachfähig mitreden können, wenn es um theologische Fragen in der Kirche geht.
2.2 Ökumenisches und interreligiöses Lernen
Zur theologischen Sprachfähigkeit gehört heute immer auch eine Gesprächsfähigkeit über Differenzen hinweg. Man könnte zunächst einmal fragen: Warum ist denn der ETK immer noch ein Evangelischer Theologiekurs. Ist das heute noch zeitgemäss?
In der Anfangszeit kam dieser Name zustande, weil es bereits einen Theologiekurs gab – und der war katholisch… Aus heutiger Sicht ist jedoch klar, dass «evangelisch» nicht für eine konfessionelle Verengung stehen soll. Wir leben längst in einem ökumenischen Zeitalter mit grossen interreligiösen Herausforderungen. Wenn wir einen evangelischen bzw. reformierten Theologiekurs anbieten, so wird deutlich:
- Theologie gibt es nie absolut, gar mit einer Art Gottesstandpunkt, sondern immer nur perspektivisch.
- Theologie kann es heute nur im Gespräch mit anderen Ausprägungen ihrer selbst geben (Ökumene).
- Theologie gibt es heute nur im Kontakt mit anderen Religionen und Weltanschauungen (Dialog).
Die Begegnung mit anderen Religionen gehört zur DNA des Theologiekurses. Das darf in der Zukunft sicher noch deutlicher betont werden.
Ich erinnere mich an eine interessante Episode aus dem letzten Kursjahr. Beim Thema Buddhismus haben wir uns mit Geschichte und Quellen bekannt gemacht. Wie bei jeder Einführung in eine andere Religion, haben wir auch hier einen Vertreter eingeladen, der eine dreistündige Einheit gestaltete. Besonders anregend und herausfordernd war eine Geschichte, die er uns vom Dalai Lama erzählte. Dieser habe einmal mit christlichen Gelehrten gesprochen und folgende Frage gestellt: Ihm sei aufgefallen, dass im Christentum ein Gefühl eine grosse Rolle spielt, das es im Buddhismus so gar nicht gibt: Das Schuldgefühl.
Und er fragte, ob ihm die Lehrer dieses Gefühl erklären könnten. Die christlichen Expert:innen schauten etwas ungläubig und versuchten es dann. Schuldgefühl, das sei zuerst ein innerer Druck, der als sehr belastend erlebt werde; ein inneres Leiden daran, etwas falsch gemacht zu haben. Zu diesem Leiden gehört eine tiefe Scham, gescheitert zu sein, auch etwas Angst, die Konsequenzen dieses Versagens tragen zu müssen, schliesslich aber auch die Sehnsucht, Vergebung der eigenen Schuld zu finden.
Ungläubig staunte der Dalai Lama und sagte: «Wir beschäftigen uns im Buddhismus sehr intensiv mit Gefühlen; aber das ist mir doch sehr fremd.» Er fragte, ob das ein hilfreiches Gefühl sei. «Aber natürlich!» sagten die Christ:innen, man müsse es doch einsehen, wenn man Fehler gemacht habe. Ob es das denn nicht im Buddhismus nicht gebe? «Schon», habe er gesagt, «aber nicht mit diesem Drama. Wer einsieht, sich verfehlt zu haben, ändert sein Verhalten. Wer etwas zerstört hat, baut es wieder auf. Wer verletzt hat, bemüht sich um Wiedergutmachung. Welchen Sinn hat es, zwischen dem Fehler und der Wiedergutmachung ein Tal schmerzhafter Gefühle zu durchschreiten?»
Auch für unsere Kursgruppe war das eine verblüffende Einsicht: Sollte es Menschen geben, die das Leiden an Schuldgefühlen nicht kennen? Interreligiöse Begegnungen sind lehrreich und herausfordernd. Was wir für selbstverständlich und notwendig halten, ist in anderen Zusammenhängen befremdlich.
Solche Begegnungen können ein Anstoss sein, auch die eigene Glaubensgeschichte noch einmal zu mustern. Und ja, in der modernen Theologie ist es seit längerem Thema, dass die Fixierung auf das Schuldgefühl und die Vergebung keineswegs notwendig zentral ist. In den Bibelwissenschaften der letzten Jahrzehnte hat sich die Einsicht durchgesetzt, dass man die Deutung von Paulus nicht bestimmen lassen darf vom introspektiven Gewissen der westlichen Christenheit, die sich besonders intensiv mit den eigenen Schuldgefühlen beschäftigt hat. Manche Selbstverständlichkeiten der westlichen Christenheit sind keineswegs biblisch zwingend.
2.3 Postsäkulare Theologie
Zuletzt gilt es, die Herausforderung unserer Zeit ernst zu nehmen. Der Theologiekurs ist kein Glaubenskurs. So hiess es in den letzten Jahrzehnten vielfach. Aus gutem Grund. In seiner Entstehungszeit nahm man sehr wohl wahr, wie erfolgreich Angebote wie Alphakurs bzw. Alpha live weltweit und auch in der Schweiz durchgeführt wurden.
Aber letztlich wurden viele dieser Angebote auf Seiten der Reformierten Kirchen als problematisch erlebt. Allzu stark war die Kurslogik, die Teilnehmenden durch alle Fragen und Zweifel hindurch zu einem Bekenntnis und zu einem Glauben zu führen, dessen Inhalt als feststehend vorausgesetzt wurde. Eine solche Logik passt nicht für die Reformierte Kirche mit ihrer Bekenntnisfreiheit und ihrer Grundüberzeugung der Vielfalt der Menschen und ihrer Zugänge zum Christentum. Darum sagte man immer wieder: Der Theologiekurs ist kein Glaubenskurs.
So richtig dieses Anliegen ist: Wir leben heute in einer anderen Zeit.
Sehr viele Menschen haben keine Grundbegriffe des Christentums mehr vermittelt bekommen, an denen sie sich kritisch abarbeiten können.
Und mehr noch: Auch theologisch verstehen wir heute besser, dass Glaube in erster Linie immer eine Praxis ist, ein Gefüge aus Haltungen, Praktiken und Ritualen. Eine stark intellektuelle Annäherung an den Glauben steht in Gefahr, ihn erst gar nicht zu Gesicht zu bekommen.
Die säkulare Gesellschaft ist längt eine postsäkulare. Nicht wenige Zeitgenossen sind neugierig auf den Glauben. Ich habe es im Laufe dieses Jahres oft gehört, dass Menschen sagten: Ich habe gemerkt, hier muss ich nichts glauben. Genau das hat mir geholfen, wieder zu einem Glauben zu finden, der mich nicht erdrückt, sondern mich trägt.
Die kritische Auseinandersetzung mit dem Glauben zerstört ihn nicht, sie öffnet neue Wege des Glaubens.
Zum Glauben gehören immer auch vielfältige Formen der Spiritualität. Hier und da haben Theologiekurse schon vor längerem angefangen, Einführungen in Praxis und Spiritualität des Glaubens zu geben. An dieser Stelle wird das klassische Gefüge des Theologiekurses sicher erweitert werden müssen. Und das natürlich in der reformierten Freiheit und Vielfalt, wie sie für unsere Landeskirchen typisch ist.
Erwachsener Glaube heute bedeutet:
- Selbstbestimmt denken. Es ist ein urreformiertes Anliegen, den Einzelnen in seiner Verantwortung vor Gott ernst zu nehmen.
- Individuelle Aneignung eines gemeinsamen Glaubenserbes. Religion wird nie völlig neu konstruiert. Wir befinden uns alle immer schon in Überlieferungsprozessen.
- Eigene Spiritualität lernen und gestalten. Glaube ist keine Theorie, keine Liste von Thesen, sondern eine Lebenspraxis, die gestaltet werden kann und muss.
- Dialogfähig glauben. Biblischer Glaube entsteht immer in der Kommunikation des Evangeliums. Weil Glaube in Gesprächen entsteht, gehört ein gewisses Mass an Gesprächsfähigkeit dazu. Nicht zuletzt denen gegenüber, denen Glaube fremd ist.
- Christliche Lebensgestaltung. Zum Glauben gehört das Handeln: Das Leben in der Liebe wie das Streben nach Gerechtigkeit.
Mit solchen Prinzipien ist der Evangelische Theologiekurs keine Sache der Vergangenheit. Solche Anliegen sind für jede kirchliche Zukunft nicht nur notwendig, sondern von zentraler Bedeutung.
Literatur
Weymann, Volker (1983): Evangelische Erwachsenenbildung. Grundlagen theologischer Didaktik. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
Plüss, David, Degen-Ballmer, Stephan (Hg.) (2008): Kann man Glauben lernen? Eine kritische Analyse von Glaubenskursen, Zürich: TVZ.
Kaleidoskop (2009). 25 Jahre ETK. Hg. von Angela Wäffler-Boveland.
Schweitzer, Friedrich (2006): Religionspädagogik. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.
Domsgen, Michael (2019): Religionspädagogik. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt.
Zürcher Disputation 84 (1987): Ergebnisse. Beiträge zur Standortbestimmung und Erneuerung unserer Kirche. Zürich: TVZ.
Bild: Regula Tanner / Forum für Zeitfragen.
Dieser Beitrag gehört zum Dossier Evangelischer Theologiekurs