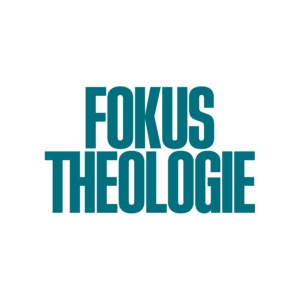1. Die steile Karriere der Dankbarkeit
Dankbarkeit hat in den letzten Jahrzehnten eine bemerkenswerte Renaissance erlebt. Einst galt sie als christliche Tugend und bürgerliche Form der Höflichkeit. Logisch, aber langweilig. Inzwischen gibt es teilweise einen regelrechten Dankbarkeits-Hype. Dankbarkeit gilt vielen als geheime Superkraft für ein gutes Leben. Die ihr zugeschriebenen Erfolgsaussichten scheinen grenzenlos zu sein.
Die Bestsellerautorin Rhonda Byrne (vgl. The Secret) veröffentlichte im Jahr 2012 ihr Buch The Magic. Darin beschreibt sie die Haltung der Dankbarkeit als Schlüssel zu einem erfolgreichen und glücklichen Leben. Hintergrund ihrer Ausführungen ist das sogenannte Gesetz der Anziehung bzw. des Manifestierens (vgl. dazu diesen RefLab-Beitrag von Manuel Schmid), das in den letzten Jahren ein immer grösserer Trend geworden ist. Byrne ist überzeugt, dass unser Bewusstsein unser Sein bestimmt. Positive Gedanken, Gefühle und Erwartungen gestalten unsere äussere Wirklichkeit. Die Mechanismen der Self-fulfilling-prophecy wirken im Positiven wie im Negativen:
„Dankbarkeit wird durch ein universales Gesetz wirksam, das Ihr ganzes Leben bestimmt. Nach dem Gesetz der Anziehung, das für die gesamte Energie im Universum gilt, von der Bildung eines Atoms bis zur Bewegung der Planeten ‚zieht Gleiches Gleiches an‘.“
Dankbarkeit wird so zum universalen Schlüssel des Erfolgs und des Glücks. Wer dankt, beantwortet damit nicht nur frühere Wohltaten. Er öffnet sich vor allem auch für weiteres Glück in der Zukunft. Wer dankt, entfaltet eine quasi magnetische Anziehung für das Gute. Dankbarkeit könne das Familienleben vertiefen und mehr: Dankbarkeit ist ein Weg zum Reichtum, erhält und steigert die Gesundheit, fördert die berufliche Karriere.
Es bedarf keiner komplizierten Übungen und Techniken.
- Denken und sagen Sie ganz bewusst das magische Wort danke.
- Je bewusster Sie dieses Wort denken und aussprechen, desto mehr Dankbarkeit empfinden Sie.
- Je mehr und je bewusster Sie Dankbarkeit denken und spüren, desto mehr Überfluss werden Sie empfangen.
Dankbarkeit – eine spirituelle Superkraft? Ist das reine Esoterik – oder ist da was dran?
2. Dankbarkeit und seelische Gesundheit
Es gibt inzwischen viele wissenschaftliche Studien, die das Veränderungspotenzial von Dankbarkeit untersuchen. Eine gute Zusammenfassung findet sich in dem Buch Dankbarkeit in der Psychotherapie von Henning Freund und Dirk Lehr. Beide haben sich jahrelang mit dem Thema Dankbarkeit empirisch beschäftigt, u.a. in der Entwicklung einer Dankbarkeits-App und vergleichenden Studien.
Grundsätzlich lässt sich sagen: Dankbarkeit tut gut. Inzwischen ist dass wissenschaftlich gut belegt. Das Ergebnis ist eindeutig, wie Freund in einem Interview feststellt:
«Die Liste der wissenschaftlich belegten positiven Auswirkungen von Dankbarkeit ist lang. Sie reicht von Verbesserungen des seelischen Wohlbefindens und der körperliche Gesundheit bis hin zu einer Stärkung des zwischenmenschlichen Zusammenhaltes.»
Ist Dankbarkeit also wirklich eine Erfolgsformel, die reich, erfolgreich und gesund mache? Nein, So Henning Freund, für so etwas gibt es keine empirische Belege. Die Studien zeichnen ein durchaus differenziertes Bild. Dankbarkeitsübungen haben einen Nutzen bei nicht zu grossen depressiven Störungen, Einschlafschwierigkeiten, Traumafolgeerkrankungen, Grübeln und Sorgen etc. (Vgl. Freund/Lehr 2020, 112ff.) Das gilt vergleichbar auch bei anderen Übungswegen wie Yoga oder Meditation.
Dankbarkeit ist keine Wunderwaffe. Bedenklich seien Trends, sich durch das intensive Einüben von Dankbarkeit persönliche Erfolge aller Art zu versprechen. Freund betont:
«Im Kern ist Dankbarkeit ein auf den Anderen fokussiertes Gefühl, und wirkliche Dankbarkeit ist immer auf den Geber ausgerichtet. Dankbarkeitsübungen, die die Beschäftigung mit dem eigenen Selbst fördern oder nur den Nutzen im Blick haben, müssen zwangsläufig nach hinten losgehen.»
Aber es bleibt der Befund: Wer wirklich Dankbarkeit einübt, d.h. positive Gefühle gegenüber anderen entwickelt, tut sich indirekt auch selbst einen Gefallen.
3. Dankbarkeit als Quelle der Ethik
In der reformierten Spiritualität spielt Dankbarkeit eine wichtige Rolle: in der Ethik. Matthias Zeindler betont in seinen Überlegungen zur Frage Gibt es eine reformierte Spiritualität?: «Reformierte Spiritualität ist handelnde Spiritualität» (Zeindler 2024, 336).
Das Thema Dank und Dankbarkeit hat in der reformierten Tradition eine grosse Bedeutung gewonnen, nicht zuletzt durch seine grundbegriffliche Verwendung in der Bekenntnistradition. Im Heidelberger Katechismus (HK) lautet der dritte Hauptteil „Von des Menschen Dankbarkeit“. Überragende Bedeutung gewinnt die Dankbarkeit als Motiv des christlichen Handelns. Auf die Frage 86, „Warum sollen wir gute Werke tun?“ lautet die Antwort:
„Wir sollen gute Werke tun, weil Christus, nachdem er uns mit seinem Blut erkauft hat, uns auch durch seinen Heiligen Geist erneuert zu seinem Ebenbild, damit wir mit unserem ganzen Leben uns dankbar gegen Gott für seine Wohltaten erweisen.“
Man kann hier offensichtlich von einer Logik des Tauschs reden: Gott hat seinen Sohn zu unserer Erlösung gegeben. Wir sollen ihm unser ganzes Leben geben (Fr 32. so auch Fr 43).
Zugleich wird diese Logik des Tauschs immer schon relativiert. Im Heidelberger Katechismus ist es völlig eindeutig, dass wir Gott keine Gegengabe geben können. Der Heilige Geist ist es, der in uns Erneuerung bewirkt. Durch seine Kraft werden wir schon jetzt erweckt zu einem neuen Leben (Fr. 45).
Das Verhältnis von Gabe und Antwort ist somit schlechthin asymmetrisch. Dankbarkeit muss verstanden werden als eine Wirkung („Frucht“) der Gabe: „Denn es ist unmöglich, dass Menschen, die Christus durch wahren Glauben eingepflanzt sind, nicht Frucht der Dankbarkeit bringen.“ (Fr. 64)
So ist es in der Bibel vorgezeichnet. In Psalm 50 wird deutlich: Gott braucht keine Opfer im Sinne menschlicher Gaben, um gnädig gestimmt zu werden.
«8 Nicht deiner Opfer wegen klage ich dich an – sind doch deine Brandopfer immer vor mir. 9 Ich will von deinem Hause Stiere nicht nehmen noch Böcke aus deinen Ställen. 10 Denn alles Wild im Walde ist mein und die Tiere auf den Bergen zu Tausenden. 11 Ich kenne alle Vögel auf den Bergen; und was sich regt auf dem Felde, ist mein. 12 Wenn mich hungerte, wollte ich dir nicht davon sagen; denn der Erdkreis ist mein und alles, was darauf ist.» (Psalm 50,8-12)
Gottes Gabe können wir nicht erstatten. Wir können sie nur empfangen. Und nichts anderes meint Dank. Dank ist keine Gabe an Gott, sondern die Anerkenntnis, dass Gott allein Geber allen Gutes ist: «14 Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde, 15 und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen.» (Ps 50,14-15)
Dankbarkeit darf nie als vorangehende oder nachfolgende Bedingung einer Gabe verstanden werden. Ulrich Zwingli hat dies in seinem Kommentar über die wahre und falsche Religion (1525), die erste reformierte Dogmatik, eindrücklich herausgearbeitet. Gott kennen wir letztlich nur aus seiner Selbsterschliessung im Evangelium von Jesus Christus. Daher fallen bei Gott unsere Erkenntnis, dass Gott ist und wer Gott ist, in eins. Denn beides verdanken wir Gott. «Also ist es einzig Gottes Werk, sowohl dass du glaubst, dass ein Gott ist, als auch, dass du diesem Gott vertraust.» (ZS III, 58)
Gott aber offenbart sich als der schlechthin Gute und Vollkommene. Gottes Güte und sein Wesen sind eins. «Dieses Sein ist ebenso das Gute, wie es das Sein ist.» (ZS III, 61) Gottes bedingungslose Güte erweist sich in seiner Freigebigkeit.
«So ist Gott freigebig, dass er denen, denen er etwas geschenkt hat, nützen will und dass er – das ist seine einzige und alleinige Absicht – denen gehöre, die von ihm geschaffen wurden; denn ohne Bezahlung will er ausgeteilt werden. … so ist er auch unaufhörlich freigebig gegenüber denen, die er dazu geschaffen hat, dass sie seine Freigebigkeit geniessen.» (ZS III, 69)
Dankbarkeit ist daher keine nachträgliche Bedingung göttlichen Gebens, sondern eine Folge davon. Sie ist ein Zeichen, dass die Gabe als Gabe erkannt und angenommen ist. Und diese Freigebigkeit Gottes befreit zu einem Leben, dass sich von Gottes Güte inspirieren lässt zu einem guten Leben in diesem Sinne.
Alles wird verkehrt, wenn die Einübung von Dankbarkeit zu einem selbstbezüglichen Leben führt, in dem man die Not anderer verdrängen muss, um sich des eigenen Glückes ungestört erfreuen zu können. Insofern ist es gut reformiert, an kirchlichen Feiertagen wie dem Erntedank Gott zu danken – und als Zeichen des Dankes auch mit anderen zu teilen.
Die kirchlichen Hilfswerke wie HEKS / Brot für alle weisen auf vielfältige Möglichkeiten hin, dem Dank für das eigene Leben in Solidarität mit anderen Ausdruck zu geben.
Zugleich birgt ein solches Verständnis von Dankbarkeit auch wieder Probleme.
Wenn Dankbarkeit zum Motiv der christlichen Ethik wird, wenn Menschen Gutes tun sollen aus Dankbarkeit, weil Gott ihnen so viel Gutes erwiesen hat – wird dann der Dank nicht doch wieder zur Pflicht? Was sollen diejenigen machen, die Dankbarkeit gerade nicht empfinden?
Zwingli löst Dankbarkeit nicht in Ethik auf. Dankbarkeit ist zuvor ein gläubiges Wahrnehmen und Empfinden der eigenen Situation vor Gott. «Das ist rechte Dankbarkeit: dass der Mensch fest daran glaubt, dass alle unsere Nahrung und unser Leben uns allein von Gott geschenkt und erhalten wird, und wir ihm dafür Dank sagen.» (ZS I, 27)
Reformierte Spiritualität ist praktisch – und das ist gut so. Eine Engführung wäre es, wenn sie in Moralität aufgehen würde. Spiritualität hat immer schon eine Kontemplative Seite. Das Gute will wahrgenommen und genossen sein. Christliche Dankbarkeit ist eine Haltung des Empfangens, die Bereitschaft, sich von Gott Gutes geben zu lassen. Diese Haltung versteht sich nicht von selbst.
4. Dankbarkeit einüben
Dankbarkeit tut gut. Und sie versteht sich nicht von selbst. Sie ist keine Leistung oder Bedingung. Wer danken muss, dankt nicht mehr wirklich, sondern erfüllt eine Pflicht. Dankbarkeit ist nur echt als Kind der Freiheit. Freiheit ist aber nicht mit Spontanität zu verwechseln. Dankbarkeit lässt sich einüben. Eine «Aufwärtsspirale» (Freund/Lehr) von Dankbarkeit und Wohlbefinden ist möglich.
In den letzten Jahren sind viele Übungsformen zur Dankbarkeit entstanden (vgl. auch Freund/Lehr 2020, 213ff. und die beigegebenen Materialien)
- Dankbarkeitstagebücher
- Dankbarkeitspostkarte an sich selbst
- Dankbriefe an andere
- Biographische Fantasiereise, mit Dankbarkeit für eigene Lebensstationen
- Auch das populäre Gebet der liebenden Aufmerksamkeit hat Anteile einer Dankbarkeitsübung
Gibt es einen spezifisch christilichen, gar reformierten Beitrag zu dieser Kultur? Die Seelensprache der reformierten Spiritualität ist die Musik. Das ist gut biblisch. „Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen.“ (Kol 3,16)
Protestantismus ist in der Vielfalt seiner Ausprägungen von reformiert bis lutherisch, hörende, vor allem aber auch singende Religion. Darum ist es kein Zufall, dass Danklieder in seiner Geschichte besondere Prägekraft haben. Traditionelle Choräle wie „Nun danket alle Gott“ haben eine besondere Wirkung entfaltet als gemeinsames Ausdrucksmedium kollektiver Dankbarkeit. Diese Prägekraft zeigt sich auch im modernen Liedgut, bis hin zu modernen Klassikern wie „Danke“, dem berühmtesten unter den neuen geistlichen Liedern.
Singen hat erhebliche Vorteile:
- Gemeinsames Singen verbindet noch einmal mehr als die private Übung.
- Regelmässiges Singen bekannter Lieder vermittelt und vertieft Einsichten, die ins Herz dringen können.
- Gute Texte prägen auch das Bewusstsein, wofür es sich zu danken lohnt.
Ein Musterbeispiel evangelischer Dankbarkeitsfrömmigkeit im Lied ist das Gedicht von Matthias Claudius «Täglich zu singen« (1777) Es gibt auch eine eher unbekannte Vertonung.
1. Ich danke Gott und freue mich,
Wie’s Kind zur Weihnachtsgabe;
Dass ich bin, bin! und dass ich dich,
Schön menschlich Antlitz habe.
2. Dass ich die Sonne, Berg und Meer,
Und Laub und Gras kann sehen
Und abends unterm Sternenheer,
Und lieben Monde gehen.
Das Lied formuliert zunächst einen grundlegenden Alltagsdank, der nicht von einer konkreten Glückserfahrung herkommt, sondern Dank als schlichten Ausdruck der Daseinsfreude formuliert. Solche Daseinsfreude wird im Danken grundsätzlich, sie erfasst das eigene Dasein als Geschenk. Dieser umfassende Dank wird verknüpft gerade mit dem Alltäglichen: Mit Sonne, Berg und Meer und natürlich mit dem für Claudius unvermeidlichen Mond.
Solche Texte helfen, Glauben im Alltäglichen zu verankern. Ein solcher gläubiger Blick auf das Leben stellt Deutungsmuster zur Verfügung, die in vielfältigen Herausforderungen der Lebensbewältigung helfen können. Das zeigen vor allem die Strophen 4 und 5 in Claudius‘ Lied:
4. Ich danke Gott mit Saitenspiel,
Dass ich kein König worden;
Ich wär geschmeichelt worden viel,
Und wär vielleicht verdorben.5. Auch bet‘ ich ihn von Herzen an,
Dass ich auf dieser Erde
Nicht bin ein grosser reicher Mann,
Und auch wohl keiner werde.
Matthias Claudius hatte Zeit seines Lebens immer wieder mit prekären Lebensumständen zu kämpfen. Nicht selten hatte er Grund zu Sorge, wenn nicht zur Bitterkeit, nicht zuletzt auch zur Zeit der Abfassung seines Liedes Täglich zu singen. Die vielfach beschwerliche wie beklagenswerte Armut erfährt in diesen Strophen jedoch eine bemerkenswerte Umdeutung. Sie wird als Schutz vor Versuchung begriffen. Ein Leben in Reichtum und Macht bringt andere Gefährdungen mit sich, führt in neue Versuchungen.
Die Haltung der Dankbarkeit ist nicht nur eine Reaktion auf erfahrene Güter. Es handelt sich um eine produktive Einstellung dem Leben gegenüber, mittels derer Wahrnehmungen möglich sind, die nicht einfach offen zu Tage liegen.
Das zeigt die Strophe 6:
6. Und all das Geld und all das Gut
Gewährt zwar viele Sachen;
Gesundheit, Schlaf und guten Mut
Kann’s aber doch nicht machen.
Die Einübung einer Haltung der Dankbarkeit erweist sich als Arbeit an der Wertehierarchie im eigenen Leben. Gesundheit, Schlaf und guter Mut werden als zentrale Merkmale des gelingenden Lebens identifiziert, über die der Mensch nicht einfach verfügt, deren Gegebensein aber auch oft nicht wahrgenommen wird. Im Lied wird das Vorhandensein dieser Lebensgrundlage bewusst gemacht und besungen. Gegenüber diesen existenziellen Voraussetzungen gelingenden Lebens werden Macht und Reichtum ausdrücklich nachgeordnet.
In diesem Dankgebet findet eine Vergewisserung christlicher Güterhierarchie statt und damit eine Sensibilisierung für weitere Dankbarkeitsgelegenheiten. Danken, das kann offensichtlich eine Grundhaltung sein, die eine vertrauensvolle Wahrnehmung meiner jeweiligen Situation stimuliert und herausfordert. Die Haltung der Dankbarkeit steigert die Entdeckungsbereitschaft für die Spuren göttlichen Segens im eigenen Alltag.
Die christliche Tradition hat kein Monopol auf die Dankbarkeit. Aber sie hält einen reichen Schatz an Liedern und Ritualen vor (wie das Erntedankfest), die die Entwicklung einer dankbaren Grundhaltung fördern und vertiefen können.
Literatur:
Byrne, Rhonda: The Magic, München 2012.
Claudius, Matthias (1976): Sämtliche Werke, München: Hanser.
Dietz, Thorsten (2015): Dankbarkeit und Gebet. Eine theologische Annäherung an Praxis, Deutung und Gefühl einer religiösen Grundhaltung. In: Thorsten Dietz / Henning Freund (Hrsg.): Gebet und Erfahrung. (SEHT 5) Berlin: LIT-Verlag, 195-230.
Dietz, Thorsten (2024): Worthaus-Vortrag Dankbarkeit
Freund, Henning, Dirk Lehr (2020): Dankbarkeit in der Psychotherapie: Ressource und Herausforderung, Göttingen: Hogrefe Verlag.
Der Heidelberger Katechismus. Revidierte Ausgabe 1997, hg. von der Evangelisch-reformierten Kirche, der Lippischen Landeskirche und vom Reformierten Bund, Neukirchen-Vluyn 52012.
Zeindler, Matthias (2024): Gibt es eine reformierte Spiritualität? In: ders.: Sich Gottes Einspruch gefallen lassen. Beiträge zur reformierten Spiritualität, Zürich: TVZ Verlag, 325-339.
Zwingli, Huldrych (1995): Schriften I und III. Zürich: TVZ Verlag. (ZS I; ZS III)
Beitragsbild:
https://pixabay.com/de/photos/kürbisse-gemüse-ernte-herbst-7545052/
Dieser Beitrag ist Teil des Dossiers Was ist Spiritualität – Praxis