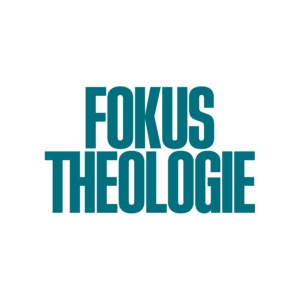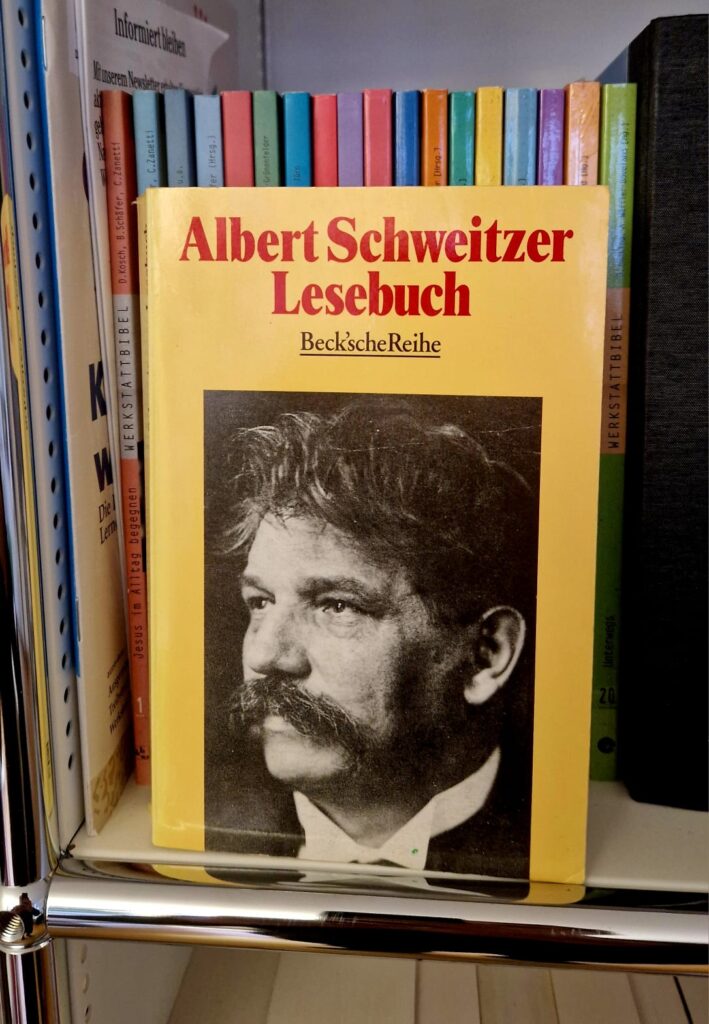Die Erinnerung an prägende Persönlichkeiten anlässlich runder Jubiläen gehört zu den Selbstverständlichkeiten unserer Kultur – auch in Kirche und Theologie. Solche Erinnerungen zeigen immer auch an, wie stark die jeweilige Wirkung noch ist.
Wie bedeutsam ist Albert Schweitzer (1875-1965) heute noch, im Jahr seines 150. Geburtstages? Ist er inzwischen ein Mann der Vergangenheit, befangen von vielen Vorstellungen und Urteilen seiner Welt, über den die Zeit hinweggegangen ist? Oder hat er uns auch heute noch Zukunftsweisendes zu sagen?
Für seine Zeitzeugen war er eine Jahrhundertgestalt. Ich wüsste kaum jemand anderen, aus dessen Biographie sich ebenso der Stoff für mehrere eindrückliche Lebensläufe gewinnen liesse. Schweitzers Leben ist in mindestens vierfacher Hinsicht aussergewöhnlich.
Biographische Querschnitte
Der Theologe
Schweitzer ist allein als wissenschaftlicher Theologe eine Ausnahmegestalt. Seine Studie über Die Geschichte der Leben-Jesu-Forschung (1906/1913) ist bahnbrechend. In präziser wie glänzender Sprache zieht Schweitzer die grossen Linien aus, wie die historisch-kritische Theologie hinter dem Christus des Glaubens nach dem wahren, geschichtlichen Jesus suchte. Eindrücklich macht Schweitzer deutlich, warum dieses grosse Projekt nur scheitern konnte. All diese vermeintlich rein historischen Ansätze waren ihrerseits von weltanschaulichen Vorannahmen und Idealen bestimmt, nach deren Mustern sie Jesusbilder entwarfen, die sie mit der Realität verwechselten.
– Nicht nur für die Leben-Jesu-Forschung wurde er wichtig. In seinem Buch Die Mystik des Apostels Paulus (1930) nimmt Schweitzer viele Kritikpunkte an einer von der Reformation bestimmten Paulusdeutung vorweg, die Jahrzehnte später vorgebracht wurden. Schweitzer deutete Paulus nicht in erster Linie als Lehrer der Rechtfertigungslehre, sondern als christlicher Denker der apokalyptischen Heilserwartung und einer quasi-mystischen Verbundenheit mit Christus.
– Schliesslich ist seine zentrale Idee der Ehrfurcht vor dem Leben bis heute ein anregender Ansatz der christlichen Ethik. Als einer der ersten kritisierte Schweitzer eine menschenzentrierte christliche Ethik und forderte, dass auch der Schutz und das Wohl der Tiere, ja ein ehrfürchtiger Umgang mit allem Lebendigen selbstverständlich werden sollten.
Der ärztliche Missionar
Als dem habilitierten Theologen Schweitzer alle akademischen Türen der theologischen Wissenschaft offen standen, begann er ein neues Leben. Mit dreissig Jahren begann er ein Medizinstudium, dass er mit der Promotion abschloss. Schon als Student war er von der Fülle seiner eigenen Begabungen und des damit verbundenen Glücks so überwältigt, dass er einen folgenreichen Entschluss fasste. Bis zum dreissigsten Lebensjahr wollte er die Vielfalt seiner Begabungen entfalten; um danach ein Leben im direkten Dienst an notleidenden Menschen zu führen.
Nach der Promotion ging er als Missionsarzt nach Lambarene im heutigen Gabun und arbeitete jahrzehntelang als Arzt bzw. Krankenhausdirektor in den Tropen. In vielen Berichten liess er die Öffentlichkeit an seinem Weg teilnehmen, sammelte Geld und schuf Aufmerksamkeit für Not und Leiden vieler Menschen ausserhalb Europas. Schweitzer war davon überzeugt, dass die bisherige Ausbeutung und Verachtung der Ärmsten ein schweres Unrecht war und dass es die zentrale Forderung sowohl des christlichen Glaubens als auch der Humanität sei, dass wir einander helfen und dienen sollen, so gut wir können.
Der Musiker
Bei seinen Geldsammlungen für die Mission brachte sich Schweitzer ganz direkt und praktisch ein – mit grossen Orgelkonzerten, die er in vielen grossen Kirchen und Kathedralen dieser Welt gab. Obwohl er in Afrika nur eingeschränkte Übungsmöglichkeiten hatte, blieben seine Fähigkeiten an der Orgel gross genug für eine solche Konzerttätigkeit. Nicht nur praktisch lag ihm die Musik nahe. Schweitzer schrieb auch ein 600seitiges Werk über Johann Sebastian Bach, das heute noch beeindruckt durch seine Einfühlungsfähigkeit in die musikalische wie religiöse Welt des grossen Komponisten. Vor seiner Ausreise nach Lambarene war Schweitzer auch einer der führenden Theoretiker des Orgelbaus, der mit vielen Schriften dazu beitrug, klassische Orgeln nicht durch maschinell gefertigte zu ersetzen, sondern ihren einzigartigen Klang durch umfangreiche Restaurationen zu erhalten.
Der Politiker
Schweitzer stammte aus dem Elsass, einer Region im Zentrum vieler deutsch-französischer Feindseligkeiten. Ein Grossteil seiner Lebenszeit war bestimmt von einer Erbfeindschaft dieser beiden Länder, die in zwei Weltkriegen ihren grausamen Höhepunkt fand. Schon vor dem Ersten Weltkrieg sah sich Schweitzer als einen, der unermüdlich „für die Verständigung zwischen Deutschland und Frankreich arbeitete.“ (Schweitzer 1959, 98)
Schweitzer sah in Nationalismus und Imperialismus ein ungeheures Versagen des Christentums. Der Einsatz für Frieden und Völkerverständigung war ihm eine Selbstverständlichkeit. Er beobachtete intensiv die politischen Entwicklungen seiner Zeit und kritisierte die menschliche Sehnsucht nach Autoritarismus und einfachen Lösungen. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte er sich mit Albert Einstein und anderen Prominenten dafür ein, ein atomares Wettrüsten zu verhindern. Er wurde u.a. 1952 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.
Angesichts dieser beinahe grotesken Fülle der Begabungen ist es kein Wunder, dass er lange als Jahrhundertmensch galt. Erstaunlich ist eher, dass er heute zunehmend in Vergessenheit gerät.
Schattenseiten
In den letzten Jahrzehnten wurden zunehmend die Schattenseiten der einstigen Lichtgestalt zum Thema. Schweitzer wirkt zunehmend wie aus der Zeit gefallen. Für die säkulare Welt wurde das Profil des Urwaldmissionars zu christlich. Den meisten kirchlichen Menschen ist sein aufgeklärter Liberalismus fremd. Für viele heutige Engagierte ist unverkennbar, wie stark er in seinem Wirken für die Armen in einem patriarchalen und kolonialen Denken verhaftet blieb. Man warf und wirft Schweitzer vor, viel zu wenig Hilfe zur Selbsthilfe geleistet zu haben. Er habe sich als guter, weisser Mensch inszeniert, der allerlei Opfer brachte, um armen, kranken Schwarzen zu helfen.
Eine berechtigte Kritik? Auf jeden Fall. In der Ikone des Urwalddoktors steckt viel zu viel «White Saviorism» (Weisses Rettertum), um sie heute noch vorbildlich zu finden. Zwar sieht auch Schweitzer schon die Kolonialgeschichte höchst kritisch:
„Zuletzt ist alles, was wir den Völkern der Kolonien Gutes erweisen, nicht Wohltat, sondern Sühne für das viele Leid, das wir Weissen von dem Tag an, da unsere Schiffe den Weg zu ihren Gestaden fanden, über sie gebracht haben.“ (Schweitzer 1959, 162).
Und doch blieb Schweitzers Sicht der grenzüberschreitenden Hilfe bis zuletzt fatal durchdrungen von Konzeptionen der Kulturvermittlung. Seine Vorstellung, dass die Zivilisierten den Unzivilisierten bei der Entwicklung helfen müssen, zeugt von einem paternalistischen und auch rassistischen Ungeist.
Es wäre zu einfach zu behaupten, dass er darin doch nur ganz Kind seiner Zeit war. Für solche Beschwichtigungen ist es so lange zu früh, wie „seine Zeit“ heute noch längst nicht abgelöst wurde durch eine neue Zeit gegenseitigen Respekts, ausgleichender Gerechtigkeit und wechselseitiger Hilfe.
Schweitzer war von der Realität und der bleibenden Notwendigkeit moralischer Fortschritte absolut überzeugt.
„Was seit 19 Jahrhunderten als Christentum in der Welt auftritt, ist erst ein Anfang des Christentums.“ (Schweitzer 1959, 199)
Die Kritik an seinem Missionsstil, so möchte ich meinen, ist daher ganz in seinem Sinne. „Gut bleiben heisst wach bleiben!“ (Schweitzer 1995, 212), heisst es bei ihm.
So sehr es eine Reihe von Punkten gibt, in denen man heute seine Grenzen sehen kann, so sehr bin ich der Überzeugung, dass Schweitzer uns nach wie in mancher Hinsicht weit voraus war.
Ehrfurcht vor dem Leben
Insbesondere seine Haltung der Ehrfurcht vor dem Leben sollte bleibende Aufmerksamkeit finden. Denn hier verbindet er Aspekte, die vielfach zu ihrem Schaden auseinander gerissen werden.
Ehrfurcht vor dem Leben – in immer neuen Anläufen versuchte Schweitzer dieser Formel Reichweite zu verschaffen. Für ihn war spätestens der Erste Weltkrieg eine Zäsur, die eine grundlegende Veränderung des Christentums nötig machte. So sehr man bezweifeln kann, dass seine weitgehende Verabschiedung einer materialen Dogmatik tragfähig sein dürfte, sollten wir seine Impulse in Zeiten erstarkenden Nationalismus und Imperialismus ernst nehmen.
Das Versagen des Christentums
„Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will“ (Schweitzer 2011, 173), so formulierte Schweitzer seine zentrale Einsicht. Worin lag für ihn das Bahnbrechende in dieser Formel, die sich ihm nach langer Besinnung in Afrika erschlossen habe?
Der Imperialismus und die Kriege der christlichen Welt nötigen nach Schweitzer zu einer klaren Diagnose: Die bisherige Gestalt von Kirche und Theologie haben insgesamt versagt. Das Ausmass, in dem die überwältigende Menge der Kirchenmitglieder bereit war, sich für abstossende Exzesse der Gewalt und Grausamkeit zur Verfügung zu stellen, erlaube keine andere Einschätzung.
Schweitzer war in seinem theologischen Denken ganz von der liberalen Theologie bestimmt. Das Versagen der Kirche zeigte sich für ihn nicht zuletzt darin, dass sie dem Aufbruch des Aufklärungsjahrhundert zu einer Kultur der Toleranz und der Vernünftigkeit nur kurze Zeit zu folgen vermochte. Schweitzer war davon überzeugt, dass es die Bestimmung des Menschen ist, sich zu freiem und aufgeklärtem Denken zu erheben, und dies in Gemeinschaft eines weltumspannenden Humanitätsbewusstseins. Konfessionelle und nationalistische Verteufelungen der jeweils anderen Seite waren für ihn ein furchtbarer Irrweg.
Die Kirchen hätten sich bald den Aufbrüchen der Aufklärung widersetzt und sich auf einen falschen Autoritätsglauben versteift.
„Wo das Christentum zu einem überlieferten Glauben wird, der den Anspruch erhebt, von den einzelnen einfach übernommen zu werden, verliert es die Beziehung zu dem geistigen Leben der Zeit und die Fähigkeit, in neuer Weltanschauung neue Gestalt anzunehmen.“ (Schweitzer 2011, 305)
Der verbohrte Glaube an unverstandene Dogmen und vermeintlich irrtumslose Instanzen wurde verbunden mit einer Ethik, die auf Akzeptanz und Befolgung von absoluten Normen und Werten beruhe. Die politische Realität zeige aber: So funktioniert es nicht. Menschen werden durch eine solche Religionskultur gewöhnt an unverständiges Befolgen noch so sinnloser Befehle. Es könne keine tragfähige Moral geben ohne innere Freiheit und Selbstständigkeit des Menschen.
Ehrfurcht vor dem Leben ist die Formel für eine Ethik im Gegensatz zu allen autoritären Sehnsüchten.
Kopf und Herz
Die aufgeklärte Ethik des 18. Jahrhunderts war von Anfang an vielschichtig. Auf der einen Seite gab es die Ansätze der moral-sense-Ethik, die das Gute in der menschlichen Fähigkeit zu Mitgefühl begründeten. Angeregt von dieser Bewegung und doch zugleich kritisch hat sich Immanuel Kant für eine rationale Ethik ausgesprochen, weil nur ein vernünftiger Ursprung der moralischen Erkenntnis diese vor der Zufälligkeit emotionaler Anteilnahme an Einzelbegebenheiten schützen könnte. Schweitzer betonte dem gegenüber:
„Wer es nicht erlebt hat, der hat nur eine angelernte Sittlichkeit, die nicht in sich gegründet ist, ihm nicht gehört, sondern von ihm abfallen kann.“ (Schweitzer 2011, 210)
Für Schweitzer ist diese Spaltung in der Wurzel eines der grössten Probleme. Die rationale Moral hat nach Schweitzer vielfältig versagt. Menschliches Handeln wurzelt im Gefühl. Ohne Mitgefühl und Anteilnahme geht es nicht. Zugleich widerspricht Schweitzer jeder reinen Gefühlsethik. Kants Einwände seien natürlich berechtigt, dass das Gute nicht einfach identisch sein könne mit dem, was mich gerade affektiv ergreift. Das Gute muss universal sein. Eine Ethik, die das Ganze im Blick hat und die zugleich jeden Menschen gänzlich ergreift, muss vernünftig und zugleich voller Mitgefühl sein.
Ehrfurcht vor dem Leben ist eine Formel, die beides umfasst. In dieser Formel liegt eine Selbsterkenntnis, ich erkenne mich als Lebendiges, das immer schon eingebettet ist in alles Leben. Und diese Erkenntnis ist gleichzeitig eine Verbundenheitserfahrung, das denkende Erlebnis, nicht getrennt zu sein.
Die Trennung der Sphären von Vernunft und Gefühl ist das Problematische. Es gilt zu lernen: „Das wahre Herz überlegt, und die wahre Vernunft empfindet.“ (Schweitzer 2011, 211) Nur eine Ethik, die sich falschen Unterscheidungen widersetzt, kann einen Massstab setzen, der künftige Bildung nicht zu kurz greifen lässt.
Mensch und Tier
Die bisherige Stellung der Tiere in der Ethik hat Schweitzer in einer vielzitierten Wendung so beschrieben:
„Wie die Hausfrau, die die Stube gescheuert hat, Sorge trägt, dass die Türe zu ist, damit ja nicht der Hund hereinkomme und das getane Werk durch die Spuren seiner Pfoten entstelle, also wachen die europäischen Denker darüber, dass ihnen keine Tiere in der Ethik herumlaufen.“ (Schweitzer 1990, S. 317)
Schweitzers Verbundenheit mit der Natur ist frei von aller Schwärmerei. Als Arzt weiss er genau, wie ambivalent das Leben oft er scheint. Es waren seine erschütterndsten Erfahrungen, wie sehr Menschen und Tiere leiden, wenn sie von anderen Formen des Lebens, von Bakterien, Viren, Parasiten befallen sind. Das Leben ist nicht einfach gütig und harmlos. Leben ist in sich voller Widersprüche.
So etwas erfahren wir nicht zuletzt auch in uns selbst. Auch wenn wir noch so sehr im Dienst an der Menschheit leben wollen, können wir nicht verkennen, dass wir mit unserem Handeln nie allen gerecht werden können. Es gibt keine einfachen Lösungen. Die Weltwirklichkeit ist voller Widersprüche, wie auch wir selbst.
„Nie dürfen wir abgestumpft werden. In der Wahrheit sind wir, wenn wir die Konflikte immer tiefer erleben. Das gute Gewissen ist eine Erfindung des Teufels.“ (Schweitzer 1990, 340)
Es gibt keine Ethik, die sich ein Leben nach der Natur zum Vorbild nehmen könne. Ehrfurcht vor dem Leben wurzelt in einer Liebe, die das Leben in seinem inneren Zwiespalt voraussetzt und immer schon überragt.
Diese in den 1910er und 1920er Jahren entwickelte Anschauung ist natürlich noch gänzlich unberührt von heutigen Fragen wie z.B. der Klimakrise. Schweitzer war in diesen Dingen seiner Zeit weit voraus. Leider muss man das für die heutige Zeit und vor allem die aktuellen politischen Trends unserer Tage noch ganz genau so sagen.
Frei und fromm
Albert Schweitzer war sein Leben lang ein liberaler Theologe. 1931 schreibt Schweitzer angesichts der immer stärker werdenden totalitären Politik: „Mit dem Geist der Zeit befinde ich mich in vollständigem Widerspruch, weil er von Missachtung des Denkens erfüllt ist.“ (Schweitzer 1959, 181) Immer stärker gehe es darum, dem Menschen „das Vertrauen in das eigene Denken“ zu nehmen, damit „er für autoritäre Wahrheit empfänglich werde.“ (Schweitzer 1959, 182f) In dieser Zeit sah sich Schweitzer ganz dem Erbe der Aufklärung und des Liberalismus verpflichtet.
Vor allem in der Schweiz hat er damit mehr noch als in Deutschland einen prägenden Eindruck hinterlassen. Für Schweizer Theologen wie Martin Werner, Fritz Buri und Ulrich Neuenschwander war Schweitzer Inbegriff und Vorbild liberal-theologischer Aufgeklärtheit und zugleich Vorbild für eine Kirche, die in der Diakonie nicht nur ein Arbeitsfeld neben anderen sieht, sondern dich sich zentral als diakonische Kirche versteht.
Spätestens in Afrika wurde es für Schweitzer wesentlich, in die Auseinandersetzung mit den Weltreligionen einzutreten. Jahrelang beschäftigte er sich mit dem Einfluss der grossen Religionen auf die ethische Lebens- und Weltanschauung. Eine blosse Beschäftigung mit christlichen oder westlichen Traditionen erschien Schweitzer schon vor 100 Jahren als provinziell.
Geistige Freiheit und persönliche Frömmigkeit gehörten für ihn wie selbstverständlich zusammen. Das Denken habe ihm den Glauben gerettet, bekannte er; ohne dass sich die Frömmigkeit in blossem Denken auflöste. Immer wieder griff er das in seiner Zeit schillernde Stichwort der Mystik auf, um zu betonen: Religion ist mehr als Rationalismus.
„Die Weltanschauung der Ehrfurcht vor dem Leben ist ethische Mystik.“ (Schweitzer 1959, 195)
Schweitzer war ein liberaler Theologe, ohne Parteigeist. Das zeigt nicht zuletzt seine Biographie. Seine Frau war aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage, ihn bei seinen Aufenthalten in Afrika zu begleiteten. Frau und Tochter fanden im deutschen Schwarzwald ein Zuhause, in Königsfeld, eine Siedlung der pietistischen Herrnhuter Brüdergemeine. Für diese pietistische Bewegung war ein Leben im persönlichen Glauben an Jesus Christus die verbindende Mitte, und dies in allen Bereichen des persönlichen und sozialen Lebens.
Der Herrnhuter Pietismus war auch damals schon etwas weiter und ökumenischer als andere Strömungen. Für Schweitzer war diese Verwurzelung wichtig. „Ich wollte, dass meine Tochter in der Atmosphäre der Brüdergemeine aufwachse“, schrieb er 1963. Seine religiöse Haltung gründete stets in einer tiefen Christusmystik. „Die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben ist die ins Universelle erweiterte Ethik der Liebe. Sie ist die als denknotwendig erkannte Ethik Jesu.“ (Schweitzer 1959, 193)
„Was dem Christentum not tut, ist, dass es ganz von dem Geist Jesu erfüllt sei und in diesem sich zur lebendigen Religion der Verinnerlichung und der Liebe vergeistige“. (Schweitzer 1959, 199)
Diese Einsicht verband ihn auch mit christlichen Strömungen, die mit seiner Theologie nichts anzufangen wussten. Eine solche innerprotestantische Offenheit war damals selten und ist es auch heute noch. Vielleicht ist dies nicht das Geringste, was es bei ihm zu lernen gilt.
Literatur:
Albert Schweitzer Lesebuch (52011). Hg. von Albert Steffahn. München: C.H. Beck.
Schweitzer, Albert (1959): Aus meinem Leben und Denken. Hamburg: Meiner.
Schweitzer, Albert (1996): Kultur und Ethik. München: C.H. Beck.
Karte und Gebiet (mit Thorsten Dietz und Tobias Faix) über Albert Schweitzer: Ehrfurcht vor dem Leben