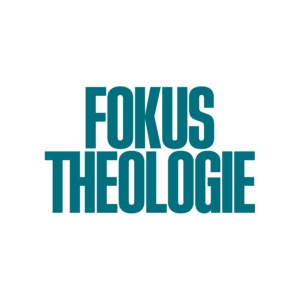Welche Bedeutung hat C.G. Jungs Werk für Theologie und Kirche heute? Lohnt es noch, sich mit ihm zu beschäftigen? Was lässt sich von ihm lernen? Und wo muss die Auseinandersetzung mit ihm kritisch geführt werden?
1. Ein befremdlicher Zeitgenosse
C.G. Jung steht uns heute eigentümlich fern und nah. Die Entwicklung der wissenschaftlichen Psychologie und Psychotherapie ist über seine Ansätze weitgehend hinweggegangen. Seine Arbeit gilt als weltanschaulich viel zu aufgeladen, so dass heute nur einzelne Aspekte seiner Psychologie rezipiert werden (wie sein Begriff der introvertierten Persönlichkeit).
Auf der anderen Seite wurde gerade diese weltanschauliche, teilweise religiöse Seite seines Wirkens immer wieder zur Inspirationsquelle. Viele seiner Anregungen sind inzwischen popularisiert worden und in veränderter Gestalt Teil unserer Kultur.
- Heldenreise. Sein Konzept der Individuation (Selbstwerdung) hat Joseph Campbell angeregt zu seinem Entwurf der Heldenreise. Auch Integrale Theorien des persönlichen Wachstums wie von Ken Wilber sind stark von C.G. Jung beeinflusst.
- Schattenarbeit. Viele Coaching-Konzepte betonen: Es gibt kein persönliches Wachstum ohne Auseinandersetzung mit den eigenen Abgründen. Verdrängung ist keine Lösung; nur was angenommen wird, kann verwandelt werden.
- Männliche und weibliche Energie. Aller kritischen Aufklärung über Geschlechterklischees zum Trotz blüht ein Beratungsmarkt (von esoterisch bis fundamental-christlich) über die Kunst, die eigene männliche bzw. weibliche Energie zu entdecken. Jungs Konzepte von Anima und Animus stehen vielfach im Hintergrund, bewusst oder unbewusst.
Nicht immer ist klar, wie tief diese Ideen in Jungs Auseinandersetzung mit dem christlichen Glaubens verwurzelt sind. Es lohnt, Jung einmal aus dieser Perspektive zu betrachten.
2. Der Pfarrerssohn: Glaubenskrise und Gnade
Carl Gustav Jung ist in einem reformierten Pfarrhaus gross geworden. Jung lernte unterschiedliche Formen religiöser Prägungen kennen, auch an sich selbst. Früh befremdeten ihn rigide und angsteinflössende Glaubensformen. Es heisst, dass er tief erschrocken war, als ein Mädchen an seiner Schule sich aus Angst vor der ewigen Hölle das Leben genommen habe. Auch Jung erlebte ansatzweise religiöse Ängste vor einem strengen Gott. Insgesamt aber blieben ihm solche Glaubensformen fremd.
Sein Vater verkörperte eher den Typus eines aufgeklärten reformierten Pfarrers. Diese Atmosphäre eines liberalen Christentums ist prägend geworden für Jungs eigenen Umgang mit religiösen Fragen. Die Bibel ist ihm ein wichtiges Menschheitsdokument, das er historisch lesen kann. Mit anderen Religionen setzte er sich zeit seines Lebens neugierig und angstfrei auseinander. Ist Jung letztlich also ein Beispiel für eine liberal-protestantische Sozialisation?
Nein – Vielmehr lässt Jung diese moderne Gestalt des Christentums enttäuscht zurück. Nicht zuletzt das Christentum seines eigenen Vater habe ihn frustriert. Im Konfirmandenunterricht seines Vaters habe er sich viel gelangweilt. Ausgerechnet beim Thema Trinität, bei dem Jung hoffte, nun würde es spannend werden, gestand sein Vater, selbst keinen Zugang dazu zu haben. Auch bei den Predigten seines Vaters war er enttäuscht. «Was er sagte, klang schal und hohl, wie wenn einer eine Geschichte erzählte, die er selbst nicht ganz glauben kann oder nur vom Hörensagen kennt.» (Jung 1988, 48).
Es gehört zu den zentralen Erfahrungen seines Lebens, dass er in jungen Jahren eine blasphemische Phantasie aufkommen spürte. Der christlichen Prägung seiner Zeit hatte er entnommen, dass jede Beleidigung oder Verunehrung Gottes einen Menschen der ewigen Verdammnis schuldig machte. Zugleich sträubte er sich gegen diese Vorstellung. Schliesslich wehrte er sich nicht mehr gegen das Aufkommen seiner Phantasie. Ausgerechnet in diesem Moment macht er eine Gotteserfahrung voller Gnade.
«An Stelle der erwarteten Verdammnis war Gnade über mich gekommen und damit eine unaussprechliche Seligkeit, wie ich sie nie gekannt hatte. Ich weinte vor Glück und Dankbarkeit, dass sich mir Weisheit und Güte Gottes enthüllt hatten.» (Jung 1988, 45).
3. Religion und Psychotherapie
Welche Bedeutung gewann die Religion für seine Form der Tiefenpsychologie? Jung teilte Freuds Entdeckungen, dass viele Menschen in Konflikte verstrickt sind, deren Gründe ihnen selbst nicht wirklich bewusst sind. Gerade auch an christlichen Klienten hatte Jung das vielfach erlebt. Immer wieder musste er feststellen, dass auch gläubige Menschen keinen Kontakt mit ihren Gefühlen haben.
«Ich habe viele kompensierende Träume gläubiger Christen gesehen, die sich über ihre wirkliche seelische Beschaffenheit täuschten und sich in einer anderen Verfassung wähnten, als es der Wirklichkeit entsprach.» (Hiob 288)
Anders als Freud gelangte er zur Überzeugung, dass es nicht nur Fragen der Sexualität oder der frühen Kindheitserfahrungen sind, die aufgearbeitet werden müssen.
«Ich habe oft gesehen, dass Menschen neurotisch werden, wenn sie sich mit ungenügenden oder falschen Antworten auf die Fragen des Lebens begnügen. Sie suchen Stellung, Ehe, Reputation und äusseren Erfolg und Geld und bleiben unglücklich und neurotisch, auch wenn sie erlangt haben, was sie suchen.» (C.G. Jung 1988, 145)
Jung war sicher, dass es oft ungelöste religiöse Fragen und Bedürfnisse sind, die Menschen belasten.
Massgeblich für seine Methode der Therapie wurde die Annahme eines kollektiven Unbewussten. Bei vielen Menschen entdeckte er in der Arbeit an Träumen und Fantasien Motive, die aus den grossen Mythen und religiösen Geschichten der Menschheitsgeschichte stammen. Gerade auch die grossen Erzählungen und Symbole des Christentums verkörperten für ihn einen Weg der Heilung, nur dass die Kirchen oft nicht mehr in der Lage seien, ihn zu vermitteln.
Schauen wir uns heute populäre Ansätze an, wie Jung wichtige Ansätze aus der kritischen Beschäftigung mit dem Christentum gewinnt.
3.1 Schattenarbeit
Heute gibt es unzählige Bücher zum Thema Schattenarbeit. Aus seiner Arbeit mit Klienten wusste Jung: Viele Menschen ringen damit, in sich Gefühle und Neigungen vorzufinden, die sie als böse und falsch empfinden. Die christliche Erziehung habe ihnen beigebracht, Regungen zur Sünde sofort zu unterbinden. Als gläubiger Mensch müsse man sich auch in Herz und Phantasie reinhalten, bevor sündhafte Impulse auch das Handeln bestimmen.
Nun kann für Jung keinen Zweifel daran bestehen, dass die christliche Rede von Schuld und Sünde etwas Wesentliches anrührt.
«Unglücklicherweise gibt es keinen Zweifel an der Tatsache, dass der Menschen im ganzen genommen weniger gut ist, als er sich einbildet oder zu sein wünscht.» (Jung 1984, 79)
Nach Jungs Erfahrung hat eine solche religiöse Moral viele angeregt, alles vermeintlich Sündhafte einer inneren Abspaltung zu unterwerfen. Es sind diese verzweifelten Abspaltungs- und Verdrängungsversuche, die nicht nur vergeblich sind, sondern Menschen auch in seelisches Leiden stürzen. «Wenn es zu einer Neurose kommt, haben wir es immer mit einem erheblich verstärkten Schatten zu tun.» (Jung 1984, 79)
In seinen eigenen Erfahrungen der Gnade und in der späteren Arbeit mit Klienten gewann Jung die Überzeugung, dass Verdrängung und Abspaltung von vermeintlich bösen Impulsen in sich selbst schädlich sei. Natürlich geht es nicht darum, alles unmittelbar auszuleben. Überhaupt erstmal bewusst zulassen und wahrnehmen was ist, darum geht es. Es gilt, «die dunklen Aspekte der Persönlichkeit als wirklich vorhanden anzuerkennen.» (Jung 2019, 17).
Nur wer dazu bereit sei, gewinne echte Selbsterkenntnis. Man muss sich zugleich klarmachen: Das bedeutet «oft eine mühselige Arbeit, die sich auf lange Zeit erstrecken kann.» (Ebd.) Wer sich weigert, problematische Anteile in sich selbst wahrzunehmen, falle immer wieder in die gleichen Fallen. Typisch sind Projektionen, die Neigung, anderen genau das zuzuschreiben, was man in sich selbst mühsam unterdrückt.
Je stärker Menschen in ihre eigenen Projektionen verstrickt sind bzw. diese mit der Realität verwechseln, desto mehr werden sie der echten Begegnung mit anderen bzw. der Wirklichkeit entfremdet.
«Es ist oft tragisch zu sehen, auf wie durchsichtige Weise ein Mensch sich selbst und anderen das Leben verpfuscht, aber um alles in der Welt nicht einsehen kann, inwiefern die ganze Tragödie von ihm selbst ausgeht.» (Jung 2019, 19)
Sich diesen inneren Abgründen zu stellen kann eine unglaublich heilsame und bereichernde Erfahrung sein. Denn nur wer sich selbst erkennt, kann auch sein eigenes Leben in die Hand nehmen. «Sobald ein Mensch weiss, dass, was immer in der Welt verkehrt ist, auch in ihm selber ist, und wenn er nur lernt, mit seinem eigenen Schatten fertig zu werden, dann hat er etwas Wirkliches für die Welt getan.» (Jung 1984, 86)
3.2 Heldenreise
Ein anderes heute höchst populäres Modell ist das der Heldenreise. Vielfach angeregt von Jung wies Joseph Campbell darauf hin, dass es in vielen grosse Geschichten immer wiederkehrende Muster gibt: Berufung zu einem Abenteuer, Reifung an Rückschlägen und Krisen, Begleitung durch einen weisen Mentor, finale Auseinandersetzung mit dem Bösen, Opfer und Triumpf, Wiederkehr in das Leben. In den meisten Hollywood-Blockbustern wird diese Entwicklungslogik wieder und wieder variiert.
Im Hintergrund steht u.a. Jungs Grundidee der Selbstwerdung, der Individuation. «Im Zentrum meiner psychologischen Entdeckungen steht wiederum ein Prozess innerer Wandlung: die Individuation.» (Jung 1988, 206)
Jung hat höchst unterschiedliche Therapieerfahrungen und andere Einflüsse zu seiner Sicht verarbeitet, nicht zuletzt aber auch die christliche Idee der Erlösung durch Jesus Christus. Jung hielt es für ein Missverständnis, die biblischen Berichte vom göttlichen Wunderwirken des Gottessohnes für Tatsachen zu halten, die man für wahr halten müsse. Solche Formen traditionalistischer Frömmigkeit hielt er durch die moderne Bibelforschung für überholt.
Unbefriedigend fand er jedoch auch das freisinnige Christentum seiner Zeit, dass sich auf moralische Werte konzentrierte und die grossen Symbole des Glaubens wie Menschwerdung, Kreuz und Auferstehung als überholt ansah. Das war für Jung ein tragisches Missverständnis. In diesen Symbolen sah er einen tiefsinnigen Ausdruck seelischer Realitäten, die bis heute jedem Menschen viel zu sagen haben.
Jung nimmt die Themen der dogmatischen Christologie ernst. Dass ein vulgäres Sühneverständnis nicht tragfähig ist, das kann Jung im Einklang mit der gesamten gelehrten Theologie in der Schweiz seiner Zeit so formulieren.:
«Man muss sich vor Augen halten: der Gott des Guten ist dermassen unversöhnlich, dass er sich nur durch ein Menschenopfer beschwichtigen lässt. Das ist eine Unerträglichkeit, die man heutzutage nicht mehr ohne weiteres schlucken kann, denn man muss schon blind sein, wenn man das grelle Licht, das von hier auf den göttlichen Charakter fällt und das Gerede von Liebe und Summum Bonum Lügen straft, nicht sieht.» (Jung 1984, 268f.)
Und doch hat die Vorstellung vom Opfer Christi überragende Bedeutung. Jesus geht einen Weg, der buchstäblich archetypische Bedeutung für die Menschheit hat. In den vielfältigen Anfeindungen und Versuchungen seines Lebens orientiert er sich nicht an Befürchtungen und Bedürfnissen des natürlichen Lebens. Er weiss sich ganz in einem Gottesglauben geborgen, der ihn befähigt, seinen eigenen Weg zu gehen, in einer heroischen Orientierung an der Güte und Gerechtigkeit Gottes.
Diesen Weg gibt es nicht ohne Opfer. Wer nicht ausweicht oder flieht, wird für die Orientierung am Guten stets Opfer bringen müssen, und sei es das eigene Leben. Aber nur wer sich selbst loslässt, kann sich behalten bzw. finden. Kreuz und Auferstehung, diese mythisch getönten Erzählungen des Neuen Testaments, beschreiben zuletzt die zutiefst menschliche Herausforderung: Das eigene Leben loslassen um es zu gewinnen, opfern um zu retten.
Zum Schaden seiner heutigen Kraft habe vor allem der Protestantismus die Bedeutung der ursprünglichen christlichen Symbole verloren. Kraftlose Religion aber vermag nicht mehr zu helfen.
«Diejenige psychologische Tatsache, welche die grösste Macht in einem Menschen besitzt, wirkt als ‘Gott’, weil es immer der überwältigende psychische Faktor ist, der ‘Gott’ genannt wird. Sobald ein Gott aufhört, ein überwältigender Faktor zu sein, wird er ein blosser Name.» (Jung 1984, 83)
4. Erneuerung des christlichen Mythos?
Je länger je mehr machte sich C.G. Jung sehr grundsätzliche Überlegungen zum Geschick der Religion und vor allem des Christentums in der Moderne.
Es sei richtig, dass «grosse Massen gebildeter Menschen unter dem Einfluss der sogenannten wissenschaftlichen Aufklärung entweder aus der Kirche ausgetreten oder von Grund auf gleichgültig gegen sie geworden sind.» (Jung 1984, 29) Aber, so gibt er zu bedenken: «viele von ihnen sind religiöse Menschen, nur nicht fähig, mit den bestehenden Glaubensformen übereinzustimmen.» (Ebd.)
Die Kirchen sind verantwortlich, die überlieferten Formen des Glaubens so weiterzuentwickeln, dass sie für die Menschen in ihrer Zeit nicht etwas sind, was man einfach glauben muss; sondern etwas, das innerlich verstanden und angeeignet werden kann und nur so auch als hilfreich und befreiend erlebt wird.
Der Verweis auf alte Bekenntnisse allein genügt nicht. «Konfessionen sind kodifizierte und dogmatisierte Formen ursprünglicher Erfahrungen. Die Inhalte der Erfahrung sind geheiligt und in der Regel starr geworden in einem unbeugsamen oft komplizierten Gedankengebäuden.» (Jung 1984, 14)
Er sah die Krise des modernen Christentums darin begründet, dass es seinen Mythos nicht weiterentwickelt hat. In seinem Buch Antwort auf Hiob ging Jung grundsätzlichen Fragen nach.
In der Bibel findet er ein Beispiel dafür, dass die Gottessymbole tatsächlich der Entwicklung unterliegen.
«Das Bemerkenswerte am Christentum ist die Tatsache, dass es in seiner Dogmatik einen Veränderungsprozess in der Gottheit antizipiert, also eine historische Wandlung auf ‘der anderen Seite’.» (Jung 1988, 330)
Mit einer reichlich spekulativen Deutung des Buches Hiob versucht Jung seine Sicht zu illustrieren. Was ist das Erstaunliche an diesem Buch? Auf der einen Seite sehen wir, wie Gott einen unschuldigen Menschen zum Gegenstand einer Wette macht und zulässt, dass schlimmste Verbrechen an ihm verübt werden. Und zugleich sehen wir, wie dieser Mensch seinem Gewissen treu bleibt und schwere Vorwürfe gegen Gott erhebt – ohne sich von Gott abzuwenden.
Das Beeindruckende an Hiob ist, dass er «nicht an der Einheit Gottes irre wird, sondern klar sieht, dass Gott sich im Widerspruch mit sich selber befindet.» (Jung 1984, 209).
Und zugleich verliert er nicht die Hoffnung auf Gott, ja er hofft auf Gott gegen Gott. Als Leser der Bibel kann man sich dem Eindruck nicht entziehen: Moralisch ist Hiob seinem Gott überlegen. Gott hat ihm Unrecht getan. Jung ist überzeugt, dass Gott selbst das so gesehen hat. Spekulativ vermutet Jung: In Gott muss eine Entwicklung in Gang gesetzt worden sein, die in der Menschwerdung Gottes zum Ziel kam. Gott selbst musste erkennen, dass Hiob gerechter war als er selbst. In der Menschwerdung nimmt Gott das Leiden und die Schmerzen der Menschen auf sich, um sich neu mit ihnen auszusöhnen.
Meint Jung das ernst? Worum es ihm geht, ist klar: Das Gottesbild hat sich schon in biblischen Zeiten entwickelt. Und es gehört zur Religion, diese Entwicklung in Form von mythischen Erzählungen zum Ausdruck zu bringen.
Jung geht an dieser Stelle noch weiter. Das christliche Gottesbild seiner Zeit sah er immer noch in einer Krise. Gott wird als der allein Gute und Gerechte beschrieben. Alles Böse kommt vom Teufel; und von den Menschen, die gehalten seien, das Böse in sich zu verurteilen. Aber dieser doppelte Dualismus, im Himmel und auf Erden, schafft immer neue Probleme. Wie beim Thema Schattenarbeit gesehen, kann ein solcher Dualismus Menschen daran hindern, ganz zu werden. Ist das dann aber nicht auch die Aufgabe Gottes? Muss er sich nicht mit seinem Schatten, dem Teufel, aussöhnen?
Für das Glaubensbewusstsein sei es an der Zeit, die alten Logiken des Schwarz und Weiss hinter sich zu lassen. Gott ist nicht nur das Licht ohne alle Finsternis.
«Letzten Endes ist es Gott, der die Welt und ihre Sünde geschaffen hat und der in Christus das menschliche Schicksal selbst erleiden muss.» (Jung 1988, 220)
So wie der Mensch sich mit seinen Schattenseiten aussöhnen muss, so muss diese Ganzheit auch auf Seiten Gottes eingeholt werden. Die blosse Leugnung des Teufels oder des Abgründigen in Gott sei keine überzeugende Lösung. Jung wusste zugleich, dass auch seine Überlegungen keine absolute Lösung darstellen können. «Was immer man sagen kann, kein Wort drückt das Ganze aus» (Jung 1988, 356)
5. Kritische Fragen
Sollten die Kirchen sich viel intensiver mit C.G. Jung beschäftigen? Vor Jahrzehnten hat Eugen Drewermann seine Deutung des Christentums aufgegriffen und für seine tiefenpsychologische Deutung der Bibel fruchtbar gemacht. Auch bei Anselm Grün lassen sich viele Einflüsse erkennen. In den letzten zehn Jahren hat vor allem der kanadische Psychologe Jordan Peterson mit seiner Bibeldeutung ein Millionenpublikum erreicht. Diese zutiefst von Jung inspirierte Deutung des Christentums ist inzwischen vom evangelikalen Fontis Verlag in der Schweiz dem lesenden Publikum auch auf Deutsch zugänglich gemacht worden. Ist es Zeit für eine Jung-Renaissance in Theologie und Kirche insgesamt?
In manchen Fragen kann Jung auch heute noch inspirieren. In anderer Hinsicht – und das zeigt sich in manchen Rezeptionen – kann sein Ansatz auch Engführungen befördern.
5.1 Romantischer Konservatismus
Kritische Stimmen weisen auf seine tiefe Verwurzelung im romantischen Konservatismus. Nun gehört die Romantik mit ihrer Betonung von Gefühl und Phantasie, Individualität und Gemeinschaft zu den bedeutendsten Strömungen der Moderne. Romantische Impulse konnte allerdings auch einseitig ausgelegt werden: als Kritik an Rationalität und Moderne, als Skepsis gegenüber Wissenschaft und Fortschritt. Neokonservative Strömungen konnten aus diesen Impulsen nationalistische und antiliberale Haltungen ableiten.
Auch bei Jung gibt es immer wieder ein skeptisches Raunen gegen alle Verlusterscheinungen in der Moderne. Die zeitweilige Annäherung des Schweizer Psychologen an den Nationalsozialismus zeigt die Abgründe, an die eine antimoderne Rezeption der Romantik führen kann.
Zu diesem Problem gehört nicht zuletzt das mangelnde Bewusstsein für die Grenzen der eigenen Disziplin und Kompetenz. Zurecht moniert Micha Brumlik: «In dem Augenblick, da die romantische Theorie der Seele ihr angestammtes Gebiet verlässt und sich auf das Gebiet der Sozial- und sogar der Naturwissenschaften begibt, verschärfen sich die explanativen Ansprüche». (Brumlik 2024, 130)
5.2 Zeit- und weltlose Ideale
Jung hatte ein Faible für vermeintlich zeitlose Ideale. Es kein Zufall, dass Jung heute in manchen konservativen Strömungen rezipiert wird. Man muss dabei auch wahrnehmen: Der 1961 verstorbene Jung ist vom Geist der emanzipatorischen 1960er Jahre unberührt. Vor allem seine Vorstellungen von männlich und weiblich sind aus moderner Sicht haarsträubend. Genau das macht dieses Denken für manche attraktiv. Wenn Jung behauptet, dass er doch nur überzeitliche Archetypen des Seelischen Lebens zu beschreiben, wird man einwenden müssen: Vorstellungen von siegreichen Helden, weisen Männern und hilfreichen Frauen sind zutiefst zeitbedingt. Und Zeiten können sich auch im positiven Sinne wandeln. Zeitlose Bilder vom Menschen gibt es nicht.
Seine psychologischen Nachfolger:innen sind sich in der Regel des zeitbedingten Charakters seiner Vorstellungen von männlich und weiblich bewusst und setzen sich kritisch damit auseinander. Popkulturell inspiriert Jung heute nicht wenige reaktionäre oder esoterische Geister, die bewusst im Modus des Kulturkampfes anknüpfen an Ideale, die sich antifeministisch und antiliberal instrumentalisieren lassen.
Auch seine Religionsvorstellungen neigen zu einer schwierigen Zeit- und Weltlosigkeit. Das macht auch seine Kritik des Protestantismus hier und da ungerecht. Der moderne Protestantismus hat sich in den letzten 200 Jahren stark auf Fragen der sozialen Gerechtigkeit, der Förderung der Freiheit und Demokratisierung konzentriert. Dass er darüber in spirituellen Fragen bisweilen fast sprachlos wurde, diese Kritik sollte man ernst nehmen.
Aber umgekehrt gilt auch: Nächstenliebe ist kein Luxus, sondern etwas Zentrales im Christentums. Die sozialen und prophetischen Anliegen der Bibel wie auch des Christentums, wie der Einsatz für den unendlichen Wert des Menschen und das Streben nach Gerechtigkeit, treten bei Jung viel zu stark in den Hintergrund. Im zweitschlimmsten Fall wird Jungs Religion weltlos und individualistisch. Im schlimmsten Fall verbindet sie sich mit reaktionären politischen Idealen.
5.3 Engführung der Bibelauslegung
So sehr sein Denken neue Zugänge zur Bibel erschlossen hat: auch hier zeigen sich die Grenzen seines Ansatzes. Wenn die Auslegung der Bibel oder des Glaubens erst mal auf solche überzeitliche Konzeptionen geeicht ist, dann wird es sehr schwer, in der Bibel überhaupt noch etwas anderes und neues wahrzunehmen. An Jung geschulte Theologie zeigt diese Probleme wieder und wieder, egal, ob es Eugen Drewermann oder Jordan Peterson ist. Die Bibelauslegung wird eigentümlich dogmatistisch. Sie reproduziert immer wieder Schemata, die sich für etliche Menschen hilfreich erweisen können. Aber die Vielfalt biblischer Texte und ihr historischer Sinn kommt chronisch zu kurz.
Jung hat ein Muster dafür entwickelt, wie biblische Texte auf menschliche Lebensfragen bezogen werden können. Der grosse Erfolg von jungianischer Bibelauslegung von Drewermann bis Peterson zeigt, dass das ein wichtiges Anliegen ist. Zugleich wird bei ihm wie auch bei seinen erfolgreichsten Nachfolgern ein Problem deutlich: Die biblische Botschaft wird verschmolzen mit den immer gleichen Deutungen, die sich vermeintlich überall in der Bibel finden lassen und diese so letztlich überflüssig machen.
Die Exegese der letzten Jahrzehnte hat vielfach gezeigt, wie vielfältig die biblischen Texte sind, in ihren Formen wie in ihren Inhalten. Eine Homogenisierung der Bibelauslegung, die einen immer wieder die gleichen Muster entdecken lässt, ist keineswegs erstrebenswert.
Wenn C.G. Jung nicht die Antwort ist, mag es ein lohnend sein, zumindest die Frage wieder zu gewinnen. Wie gelingt es, die Leistung der historisch-kritischen Forschung mit ihrer Anwaltschaft für die ursprüngliche Anwaltschaft der biblischen Texte zu verknüpfen mit einer Anknüpfung an heutige Lebensfragen?
6. Fazit
C.G. Jung ist nicht zu verstehen ohne seine lebenslange Auseinandersetzung mit dem Christentum. Und daraus lässt sich bis heute manches lernen. Jungs Überlegungen zur Abspaltung und Verdrängung des Bösen – im Menschen und in Gott, sind bis heute anregend. Sein Vorschlag, auch die Figur des Teufels in Gott zu integrieren, ist symbolisch letztlich abwegig. Denn ja, das Abgründige, Unverständliche gehört zur Gotteserfahrung, wie viele biblischen Texte eindrücklich zeigen. Und zugleich gehört es zu den zentralen Einsichten der Reformation (und vielfach auch der Ökumene), dass das Evangelium das unbedingte und eindeutige Ja Gottes zum Ausdruck bringt. Kirche und Theologie sollten sich niemals ausreden lassen, was der wahre Schatz ihres Glaubens ist: das einfache Evangelium von der Liebe Gottes von Jesus Christus.
Mit seiner Betonung der starken Bedeutung von Bildern und Symbolen für die Religion hat Jung wichtige Impulse gegeben. In seiner Weise formulierte er eine bescheidene religiöse Hoffnung, die in ihrer Zaghaftigkeit vielen Zeitgenossen näher stehen dürfte als die vollmundige Sprache früherer Generationen:
«Die Welt, in die wir hineingeboren werden, ist roh und grausam und zugleich von göttlicher Schönheit. … Wahrscheinlich ist, wie bei allen metaphysischen Fragen, beides wahr: Das Leben ist Sinn und Unsinn, oder es hat Sinn und Unsinn. Ich habe die ängstliche Hoffnung, der Sinn werde überwiegen und die Schlacht gewinnen.» (Jung 1988, 360)
Wer überzeugt ist, dass die christliche Botschaft auch heute allen Menschen etwas zu sagen hat, findet bei C.G. Jung zumindest die Anregung, dass wir dafür eine Sprache finden müssen, die wieder verstanden wird.
«Ich lasse der christlichen Botschaft nicht nur eine Tür offen, sondern sie gehört ins Zentrum des westlichen Menschen. Allerdings bedarf sie einer neuen Sicht, um den säkularen Wandlungen des Menschen des Zeitgeistes zu entsprechen; sonst steht sie neben der Zeit und die Ganzheit des Menschen neben ihr.» (Jung 1988, 213)
Literatur
Brumlik, Micha (32024): C.G. Jung. Zur Einführung. Hamburg: Junius.
Heine, Susanne (2005), Grundlagen der Religionspsychologie. Modelle und Methoden. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Jung, C.G. (42019): Aion. Beiträge zur Symbolik des Selbst. Ostfildern: Patmos Verlag.
Jung, C.G. (61988): Erinnerung, Träume und Gedanken. Aufgezeichnet und herausgegeben von Jaffé, Aniela. Olten: Walter Verlag.
Jung, C.G. (1984): Menschenbild und Gottesbild. Psychologie und Religion, Das Wandlungssymbol in der Messe, Antwort auf Hiob. Grundwerk C.G. Jung Bd. 4. Olten: Walter Verlag.
Vgl. auch: 150 Jahre C.G. Jung und das Erbe der modernen Psychotherapie. (23. Juni 2025). Sternstunde Philosophie (SRF Kultur).