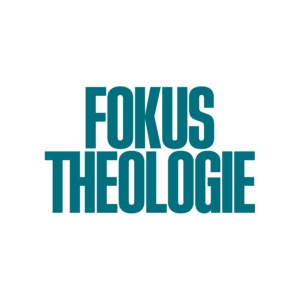2024 haben wir das vierzigjährige Jubiläum des ETK gefeiert. Im Rahmen der Jubiläumsfeiern wurde deutlich, welche Wertschätzung der ETK insgesamt geniesst. Das Team von Fokus Theologie hat dieses Jubiläumsjahr genutzt, sich mit Geschichte und Gegenwart des Theologiekurses vertraut zu machen. Das Verständnis der geschichtlichen Entwicklung des ETK ist sehr hilfreich, seine heutige Gestalt zu verstehen.
1. Formative Phase (1984-1996)
– Der Evangelische Theologiekurs für Erwachsene (ETE) wurde in einem Gemeinschaftsprozess von Theolog:innen aus unterschiedlichen Regionen der Deutschschweiz entwickelt. Federführend war die Stelle für Erwachsenenbildung in Zürich (Volker Weymann), organisatorisch und inhaltlich unterstützt von Felix Marti, der von der Reformierten Kirche Graubünden dafür freigestellt wurde.
– Der Grundriss war durch eine klare Gesamtkonzeption geprägt. Volker Weymann hatte in seinem Buch Evangelische Erwachsenenbildung. Grundlagen theologischer Didaktik (1983) ein Leitbild im Sinne einer Hermeneutischen Theologie entworfen, dessen Grundgedanken sich im Kurskonzept deutlich abzeichnen.
– Zentraler Gedanke dieser hermeneutischen Dialoge ist die Verbindung heutiger Lebenserfahrung mit den Quellen der Bibel und der christlichen Tradition, die ihrerseits als Verarbeitung menschlicher Erfahrungen im Glauben zu verstehen sind. So zielen die Kurseinheiten zur Bibel durchwegs auf einen «Dialog mit der Bibel und zugleich mit Lebensfragen», wie Volker Weymann im Vorwort NT von 1991 betont.
– Die Lebenserfahrung der Teilnehmer:innen und unserer Gegenwart und die Glaubenserfahrungen, wie sie in Bibel und Kirchengeschichte Gestalt gewonnen haben, werden aufeinander bezogen. Didaktisch ist dafür der klassische Ansatz der Elementarisierung massgeblich: Nicht Überblicksvorlesungen oder ähnliches, sondern die gemeinsame Arbeit an zentralen Quellen sollen grössere Zusammenhänge erschliessen (vgl. vor allem Einleitung NT, Weymann 1985). Besondere Bedeutung für die Kursabende hatten daher von Anfang an die Auseinandersetzungen mit vielfältigen kulturellen Verarbeitungen der christlichen Botschaft in Malerei, Literatur und Musik, weil sich an diesen Quellen besonders eindrücklich die immer neue lebensweltliche Auseinandersetzung mit Glaubensfragen in der Geschichte zeigen lässt.
– Dieser Ansatz bestimmt alle Kursteile, auch Glaubenslehre, Ethik, Religionen oder Kirche:
«Der Theologiekurs ist bewusst so aufgebaut, dass wir uns über die drei Kursjahre hin nicht erst nach und nach Herausforderungen annähern, die uns in unserm Leben heutzutage beschäftigen. Vielmehr sollen jedes Jahr verschiedene Zugänge zu theologischen Entdeckungen so ineinander greifen, dass wir von der Bibel wie von gegenwärtiger Lebensverantwortung her an Fragen, die uns vertraut sind, wie an Fragen, die uns herausfordern und überraschen können, lebensbezogener Theologie auf der Spur bleiben: dabei wird die Sache schon deshalb spannend, weil Lebenserfahrungen und Glaubensfragen sich gegenseitig herausfordern und erschliessen.» (Vorwort Ethik, Weymann 1989)
– Die Kursunterlagen hatten einen doppelten Zweck: Sie sollten den Kursleitungen Grundlage zur Vorbereitung auf dem Niveau heutiger Wissenschaft sein. Gleichzeitig sollten sie den Teilnehmenden zur Nacharbeit und gegebenenfalls zur Vorarbeit dienen. Zugleich sollten sie je nach Rückmeldungen der Beteiligten beständig weiterentwickelt werden. Zu ihrer Anlage gehörte auch der Verweis auf weiterführende Studien aus der heutigen Theologie. Grundsätzlich sind die Kursunterlagen dem Gesamtanliegen des Theologiekurses verpflichtet:
„Der Theologiekurs sucht lebensbezogener Theologie zu entsprechen. Dem sollten auch die Arbeitsunterlagen dienen.“ (Vorwort Christologie, Weymann 1984)
2. Erneuerungsphase (1996-2000)
Mit dem Fortgang von Volker Weymann (1996) zum Theologischen Studienseminar der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) in Pullach begann eine neue Phase des Theologiekurses. Die neue Verantwortliche Sophia Bietenhard hat zu Beginn ihrer Wirkungszeit 1996 beschrieben, in welche Richtung sie sich eine Veränderung vorstellen könnte (IBK-Protokoll, 23. September 1996). Im nächsten Jahr stellte sie ein neues Konzept vor, das von der IBK bewilligt wurde. Der ETE wurde nun zum Evangelischen Theologiekurs (ETK). Die Neuausrichtung wurde in einem Leitfaden für Kursverantwortliche (1998) erstmals beschrieben. Langfristig prägend wurden folgende Aspekte:
– Baukastensystem. Das bisherige dreijährige curriculare Kurssystem sollte sich stärker für ein flexibles modulares System öffnen. Der Theologiekurs sollte als Baukastensystem einzelner Einheiten funktionieren, die jeweils auch für sich belegt werden können. Die neue Konzeption ist im Leitfaden für Kursverantwortliche (1998) dokumentiert. Auf dem Beitragsbild kann man die Gesamtlogik des Kurses gut erkennen: 5 Themenbereiche machen das inhaltliche Rückgrat des Theologiekurses aus. Das Windrad macht deutlich, dass diese zentralen Themenbereiche (Bibel, Ethik, Theologie, Religionen und Kirchengeschichte) jedes Jahr einander abwechseln, so dass sich ihre Zugänge zur Theologie durchgehend ergänzen. Die einzelnen Module sind Teil eines Gesamtentwurfs, sie können aber auch jeweils für sich besucht werden.
– Perspektivenvielfalt. Die neuen Kursunterlagen (statt früher Arbeitsunterlagen) weisen vor allem eine Integration neuer Perspektiven auf: Alternative Zugänge zur Bibel, vor allem feministische Theologie, Befreiungstheologie und Sozialgeschichte, sowie eine stärkere Berücksichtigung der Multireligiosität der Gesellschaft. So wurden Module geplant bzw. erstellt wie «Sophia – Weisheit und Feministische Theologie» und «Religion und Biografie». War der Theologiekurs ursprünglich stark biblisch-hermeneutisch geprägt, so wurde nun eine innere Pluralisierung der Ansätze verstärkt.
– Einzelseminare. Einzelne Veranstaltungen des Kursgeschehens, aber auch Sonderveranstaltungen sollten für Interessierte geöffnet werden. Auf diesem Wege sollte der ETK flexibler auf neue Themen reagieren können und grundsätzlich auch zugänglich werden für Menschen, denen ein mehrjähriges Kursprogramm zu viel ist.
3. Ausdifferenzierungen (2001-2021)
– Nach dem Ende der Amtszeit von Sophia Bietenhard (2000) begann wiederum eine neue Zeit. Angela Wäffler trat ihre Nachfolge 2001 an. In verschiedener Hinsicht kam es zu einer Periode der Ausdifferenzierungen. Die Neuauflage des Leitfadens von 2004 hält grundsätzlich an der Möglichkeit eines modularen Systems fest, betont aber wieder stärker die besondere Leistungsfähigkeit des dreijährigen curricularen Ansatzes.
– Die Theologiekurse entwickelten sich in unterschiedliche Richtungen. Einige Kurse hielten fest an der Leitidee eines Dreijahreskurses (Aargau, Basel, Bern, Zürich) Andere setzten das Baukastensystem um und entwickelten zunehmend eigenständige Angebote, die für die regionalen Bedürfnisse passend waren (St. Gallen, Graubünden, Thurgau).
– – Diese unterschiedliche Entwicklung der verschiedenen Theologiekurse entstand teilweise auch deshalb, weil die regionalen Kirchen verschiedene Erwartungen haben. Für manche, vor allem kleinere Kirchen ist der Theologiekurs ein Fort- und Ausbildungsangebot, das Grundwissen für Katechetinnen, Prädikantinnen oder auch sozialdiakonisch-Tätige vermittelt. Andere Kurse werden hingegen ganz auf freiwilliger Basis und aufgrund persönlicher Weiterbildungsinteressen besucht.
– Die deutlichste Ausdifferenzierung zeigte sich in der Weiterentwicklung der Kursunterlagen. Wo in der formativen Phase die Unterlagen von Theolog:innen gestaltet worden waren, die gleichzeitig in Kursleitungen eingebunden waren, traten nun die Unterlagenerstellung und die Kursdurchführung deutlich auseinander. Kursunterlagen wurden entwickelt von Teams, die aus Wissenschaft und Erwachsenenbildung stammten. Aktuelle fachwissenschaftliche Debatten wurden so gut es geht in den Kursunterlagen referiert und für hochinteressierte Teilnehmende zugänglich gemacht.
– Zugleich wurde nun das erwachsenenbildnerische Profil des Theologiekurses deutlich geschärft. In der Gründungsphase des ETK gab es insgesamt noch kaum einen spezifisch pädagogischen Diskurs zur theologischen Erwachsenenbildung. Die Weiterentwicklung der allgemeinen Didaktik prägt nun zunehmend auch den Theologiekurs. Neue Ansätze wie die konstruktivistische Didaktik bestimmen nun die Diskussion.
Folgende Merkmale der Erwachsenenbildung bestimmten nach dem «Leitbild der Fachstelle Erwachsenenbildung & Theologie» (2006) die Durchführung des Theologiekurses:
- Ganzheitliche Auseinandersetzung mit der christlichen Tradition, «mit Geist, Seele und Körper»
- Emanzipatorische Befähigung, «Freiraum für neue Denk- und Erlebensmuster» zu entwickeln.
- Gestaltung vielfältiger Lernorte, im Alltag wie in persönlicher Spiritualität, in solidarischer Weggemeinschaft wie sozialer Verantwortung
- «Unsere Erwachsenenbildung befähigt zu einem spielerischen und kreativen Umgang mit schon vertrauten und noch zu entdeckenden Denk- und Erlebensmustern.»
- «Unsere Erwachsenenbildung begleitet Menschen bei der Vergewisserung ihrer religiösen Identität im Freiraum einer nachchristlichen und multireligiösen Gesellschaft.
– Neue Einsichten der Erwachsenenbildung prägen nun auch das Leitbild der Fachstelle insgesamt.
Im Zentrum steht weniger die Vermittlung einer christlichen-theologischen Gesamtsicht, sondern die Befähigung der Teilnehmenden, ihre eigenen Zugänge zur christlichen Tradition zu entdecken und zu gestalten.
Der Subjektstatus der Kursmitglieder wird deutlicher respektiert.
– Sichtbar wird auch, dass die Entwicklung von Kursmaterialien und Kursveranstaltungen teilweise als herausfordernd empfunden wurde. In der wissenschaftlichen Theologie an den Universitäten kommt es zu einer zunehmenden Spezialisierung und Ausdifferenzierung der Forschung. Die Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Debatten innerhalb und ausserhalb der Theologie verdrängt zunehmend das in früheren Jahrzehnten noch starke Anliegen, ein reflektiertes Christentum für eine interessierte Öffentlichkeit zu vermitteln.
– In den 2010er Jahren war die Teilnahme am ETK insgesamt rückläufig. In dieser Entwicklung spiegelt sich eine Gesamttendenz der Reformierten Kirchen. Sowohl die Zahlen der Kirchenmitglieder als auch die Beteiligungsrate der Reformierten wurden stetig geringer. Konnte der Theologiekurs in den 1980er Jahren seine Teilnehmenden in einem breiten Milieu engagierter Kirchenmitglieder finden, so ist aus der Mehrheitskirche heute eine Minderheitenkirche geworden.
4. Neuaufstellung der Fachstelle 2022
Anregend wie hilfreich sind nach wie vor die Ergebnisse der 2021 vorgestellten Marktforschung für die Fachstelle Fokus Theologie. Die Umfrage bei unterschiedlichen Gruppen von Beteiligten hat einige zentrale Befunde deutlich gemacht:
- Bei aktuellen und ehemaligen Teilnehmenden gibt es nach wie vor eine sehr hohe Zufriedenheit mit dem Theologiekurs.
- Die positive Bewertung des Theologiekurses ist da am höchsten, wo er freiwillig und ohne Ausbildungskontext gewählt wird. Es gibt jedoch auch viele Erfahrungen, dass der ETK als Teil eines Ausbildungszusammenhangs als hilfreich und gewinnbringend empfunden wird.
- Bei Verantwortlichen und auch Pfarrpersonen ist der Theologiekurs nicht mehr so bekannt und präsent wie in den Anfangsjahren.
Der Theologiekurs wird gesamtkirchlich wahrgenommen als eine wichtige Säule gesamtkirchlicher Fort- und Ausbildung. Das zeigt sich nicht zuletzt in seiner Anerkennung durch Diakonie Schweiz 2023 als Erfüllung der Anforderungen der kirchlich-theologischen Grundlagen, wie sie für eine Anerkennung als Sozialdiakon:in nötig sind. Seit Jahren sind die Teilnahmezahlen am Theologiekurs stabil bzw. leicht wachsend. Der Theologiekurs bleibt ein zentrales Projekt der Fachstelle Fokus Theologie. Seine Weiterentwicklung in den nächsten Jahren wird zentrale Linien seiner bisherigen Entwicklung fortführen und neue Akzente setzen, die zu einer stärkeren Verzahnung von wissenschaftlichen Informationen und lebensweltlichen Fragen sowie von analogen und digitalen Angeboten führen.