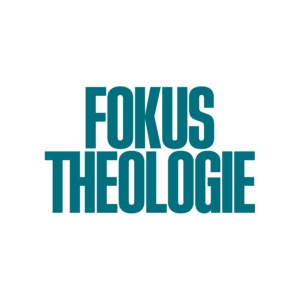Jordan Peterson ist seit einigen Jahren eine der bekanntesten Stimmen im nordamerikanischen Kulturkampf. Jetzt legt er ein Buch mit Bibelauslegungen vor, das wir schon im Podcast Geist.Zeit besprochen haben. Lässt sich dieses Buch trennen von seinem politischen Engagement? Nicht alles darin ist Politik. Aber vieles.
1. Chaos und Ordnung
Sein Weltbestseller 12 Rules for Life machte mit seinem Untertitel deutlich, was Peterson vor allem bieten wollte: «An Antidote to Chaos». Schon in diesem Buch liess Peterson keinen Zweifel daran, dass er gerade in dieser Hinsicht die Texte der Bibel auch für unsere Zeit als höchst relevant ansieht. Im zweiten Kapitel dieses Buch betont er, wie sehr ihm die Schöpfungsgeschichten des biblischen Buches Genesis geholfen haben, die grundsätzliche Bedeutung des Gegensatzes von Ordnung und Chaos zu verstehen.
In seinem grossen Buch über Gott von 2024 (We Who Wrestle With God) wird dieses Thema ausführlich entfaltet. Peterson spricht damit in der Tat ein zentrales Thema antiker Schöpfungsvorstellungen an. In vielen Schöpfungsmythen des Orients geht es nicht um die moderne Frage nach Anfang und Ursache des Universums. Die Frage nach dem Anfang ist immer schon gestellt als: Frage nach dem Ursprung des Kosmos in einer Welt des Chaos.
Die meisten Mythen erzählen keine Weltentstehungsgeschichten, sondern Weltordnungsmythen: Wie haben die guten Götter das Chaos gebändigt? Wenn sich Peterson immer wieder auf orientalische Mythen wie Enuma Elish bezieht, ist das auch historisch-exegetisch gut begründet.
So liest Peterson die biblischen Schöpfungstexte, es sind Narrative, in denen die geistig-moralische Ordnung des Kosmos verdeutlicht wird. Ebenfalls mit Recht lässt Peterson keinen Zweifel daran, dass diese Erzählungen natürlich keine Konkurrenz zur heutigen naturwissenschaftlichen Sicht sind. Entscheidend ist ihm die Bedeutung dieser kosmischen Logik auch für die Menschenwelt:
Keine Welt funktioniert ohne Ordnung und Struktur; natürlich wie gesellschaftlich.
Der Zusammenhang des Ganzen muss Ausdruck finden in einer hierarchischen Ordnung, die von gemeinsamen moralischen Überzeugungen getragen ist. Wo diese verschwinden, droht das Chaos.
Schon in 12 Rules for Life hat Peterson aus dieser Grundidee eine von vielen begeistert aufgenommene Liste von Lebensregeln entwickelt, die auf klassische Tugenden wie Fleiss, Ordnung und Verantwortung setzt. Je länger, je mehr hat Peterson seine Ansätze für individuelle Lebenshilfe auch auf den politischen Raum ausgedehnt. Auch die Gesellschaft brauche mehr moralische Ordnung, mehr Autorität und Hierarchie. Und daher sei es Zeit, auch Gott wieder zu einem öffentlichen Thema zu machen.
2. Gott und das moralische Streben
Gott ist für Peterson ein wichtiges Thema, weil er im Gottesgedanken die Idee erkennt, die die kosmische Wohlordnung begründet und gewährt. Es geht Peterson in seinem Buch nicht um eine persönliche Gottesbeziehung, die von Liebe und Vertrauen getragen ist, gar mit einem heilsgeschichtlichen Horizont von Sünde und Erlösung. Glaube versteht sich bei ihm im Rahmen einer moralischen Religion. «Ohne wahre moralische Ordnung kann es keinen Wohlstand geben» (25).
Alle biblischen Bilder von Heil und Erlösung werden zu Metaphern für diesseitige Ziele.
«Das gelobte Land» sollte verstanden werden «als ein Zustand, der durch anhaltendes moralisches Streben des Einzelnen und der Gemeinschaft geschaffen wird.» (Peterson 2024, 517) Vielleicht liessen sich Tod und Leiden nicht völlig überwinden, aber so verzögert und gebremst, das «Leben in Fülle gefördert und ausgedehnt» wird (vgl. Joh 10,10); Wir können so leben, dass «die volle Hingabe an das höchste Ziel und Abenteuer unserer schmerzhaften Begrenzung und Sterblichkeit zumindest den Stachel nimmt». (ebd.) Der Stachel des Todes ist für Paulus ein Bild dessen, was die Auferstehung Christi überwindet (1Kor 15,55).
Die gesamte christliche Sprache der Erlösung wird moralisch vereinnahmt:
«Wir wollen das Gute verstehen, damit wir gut sein können, und das Böse verstehen, damit wir nicht böse sein müssen. Auf diese Weise können wir das Heil und die Erlösung der Welt bewirken, im Kleinen wie im Grossen.» (A.a.O., 34)
Eine solche Aussage ist nicht nur ein Ausrutscher oder eine Übertreibung. Heil und Erlösung werden zu Formeln einer moralischen Wohlordnung. Es geht ihm nicht um eine Leistungsreligion, in der sich Menschen so etwas wie ein jenseitiges Heil verdienen können oder müssen. Die biblischen Bilder eines Jenseits sind ihm sämtlich Chiffren des Diesseits: «So können wir die Hölle eindämmen, die das Böse hervorbringt, und zwar nicht nur für uns selbst, sondern für alle, die wir lieben, für die Stabilität und den Fortbestand der Gesellschaften, in denen wir leben und für die Liebe zur Welt selbst.» (Ebd.)
Die Bibel ist für ihn keine Offenbarung eines transzendenten Gottes, in der der Weg zum Heil für alle Welt offenbart wird. Viel prosaischer gebraucht er die Bibel als eine moralische Landkarte, die vor allem für den westlichen Kulturraum grosse Prägekraft gewonnen hat:
«Die Bibel ist die Bibliothek der Geschichten, auf der die produktivsten, freiesten, stabilsten, und friedlichen Gesellschaften beruhen, die die Welt je gesehen hat – das Fundament des Westens, schlicht und einfach.» (S. 34)
Was es nirgendwo gibt, ist so etwas wie ein Heilshandeln Gottes, ein sola gratia, eine Versöhnung mit Gott in Christus, eine soteriologische Bedeutung von Christus und Glaube. Durchweg wird Jesus als Urbild verstanden, als Held der Hingabe und als Lehrer der moralischen Wahrheit. In der klassisch-dogmatischen Sprache ist Christus exemplum (Vorbild), nicht sacramentum (Heilsgabe).
Gott ist für Peterson der Inbegriff der moralischen Ordnung des Seins.
«Etwas muss unverrückbar als Basis verankert oder dauerhaft an die höchste Stelle erhoben bleiben». (87)
Sein Gottesbild ist keineswegs nur statisch. Gott ist für ihn auch die Stimme, die zum Abenteuer lockt, die Inspiration und Berufung zur je persönlichen Heldenreise. Vor allem ist Gott die Stimme des Gewissens, die Mahnung zum Guten und zur Wahrheit, der Garant für «die angemessene Wertehierarchie» (33), die Grundlage für verantwortliches Handeln, das Ziel für unser moralisches Streben.
3. Petersons Bild der heutigen Kulturkämpfe
Für seine Auseinandersetzung mit den Problemen unserer Zeit spielt die Erzählung von Kain und Abel eine zentrale Rolle (137-212). Diese beiden Brüder haben für Peterson archetypische Bedeutung. Abel steht für eine Haltung, die Gott in aufrichtiger Weise Verehrung darbringt und damit die Ordnung und die hierarchische Struktur des Kosmos anerkennt. Kain, der seinen Bruder erst beneidet und dann tötet, steht für den Aufruhr gegen genau diese zentralen göttlichen Werte. Diese Geschichte ist für Peterson ein Schlüssel zur Deutung auch unserer Zeit:
«Ein Grossteil der Spaltung, die die Welt heimsucht, ist eine Folge des Gegensatzes der beiden Haltungen, die in der ursprünglichen Geschichte von den verfeindeten Brüdern so deutlich dargestellt werden. Die Geschichte von Kain und Abel hat daher eine Bedeutung, die direkt in das Politische hineinreicht». (154)
Warum? Die Welt ist voller Unterschiede und Ungleichheiten. Für Peterson ist das unvermeidlich. Menschen sind unterschiedlich leistungsfähig und begabt, das zieht notwendigerweise eine Ungleichheit in Macht- und Vermögensverhältnissen nach sich. Entscheidend sei ein verantwortlicher Umgang mit der Macht, der der Gesellschaft insgesamt nütze. Die heutigen politischen Spannungen würden von denjenigen verursacht, die auf «höchst eigennützige Weise» unterstellen, dass all diese Ungleichheiten nicht etwa eine unvermeidbare Folge der Unterschiede selbst sind, sondern auf Zwang, Gewalt und Unterdrückung zurückzuführen sind.» (155)
Seit 12 Rules for Life wissen wir, wie wesentlich Peterson eine natürliche, vermeintlich durch Leistung begründete Hierarchielogik findet. Für Peterson ist Ordnung immer eine «hierarchische Ordnung» (351). So etwas glaubt er es in den biblischen Texten zu finden.
Für Peterson mag sämtliche Kritik an Sexismus und Patriarchat, an Kapitalismus, Kolonialismus und Imperialismus, zwar in Einzelfällen berechtigt sein. Jede strukturelle Kritik lehnt er ab. Grundsätzlich sieht Peterson in all diesen sozialkritischen Bewegungen und Ansätzen den Geist Kains am Werk; einen Geist des Neides und der Rache.
Aus dieser Perspektive deutet Peterson die Geschichte der modernen Welt: «Die aufgebrachten und mörderischen und schliesslich völkermordenden Jakobiner, die erst die Französische Revolution planten und sie dann vollständig an sich rissen, waren die geistigen Nachkommen Kains.» (156) Die Ordnung des “Ancien Régime” ist ihm keine Silbe wert.
Das gleiche gilt für Karl Marx und den Marxismus, für die russische Revolution unter Lenin, schliesslich für die 68er und die sexuelle Revolution sowie auch die postmoderne Kritik an Sexismus und Kolonialismus.
All diese progressiven Gruppierungen, die sich für soziale Gerechtigkeit oder Umweltschutz einsetzen, hätten sich in der Regel von der Geltung aller Normen und Werte befreit. Die postmoderne Betonung der jeweiligen Machtinteressen im Diskurs zerstöre jedes klassische Konzept von Wahrheit. Letztlich wollten diese Aktivisten wollten nur «ihre im Wesentlichen hedonistischen und egoistischen Ziele erreichen». (157)
Die Entwicklung immer neuer kollektiver Identitäten der ethnischen Herkunft, des Geschlechts und der sexuellen Orientierung hätten nur den Zweck, die Welt in einen beständigen Kulturkampf zu stürzen. Im Geiste des Neides Kains sehen sich viele nur als ewige Opfer. Die Nachfolger:innen Kains sehen die Frauen durch Männer unterdrückt, die Armen durch die Reichen und Minderheiten verschiedener sexueller Identität durch die Gesellschaft.
Peterson kritisiert vor allem die Idee einer strukturellen Ungerechtigkeit. In seinem Menschenbild hängt alles am Individuum. Dass ein solcher Individualismus dem biblischen Denken völlig fremd ist, ignoriert er vollständig.
Kann man auf diese Themen kommen in der Auslegung biblischer Texte? Und wie?
4. Kampf gegen Gender und Queerness
Kein Thema wird so ausführlich erörtert wie Geschlechterfragen. Dieser Schwerpunkt ist natürlich auch den biblischen Texten und ihren Erzählungen von der Menschenschöpfung geschuldet. Das Thema Mann und Frau ist für Petersons Buch absolut zentral.
«Wir befinden uns derzeit in einem Krieg über die grundlegendste aller Fragen: die des Geschlechts.» (282)
Warum? Worin sieht Peterson das Problem unserer Zeit? Peterson ist überzeugt, dass eine binäre Unterscheidung von zwei Geschlechtern und die Kenntnis ihrer Wesenseigenschaften absolut notwendig ist. Angeregt von C.G. Jungs Unterscheidung von Anima und Animus und ohne sich auch nur ansatzweise auf die modernen Gender-Debatten einzulassen, unterstellt er, dass Fragen des Geschlechts heute der persönlichen Willkür überlassen seien. «Weil wir beschlossen haben, uns das Recht auf absolute Selbstdefinition anzueignen, anstatt sie im Herrschaftsgebiet des Transzendenten oder des Axiomatischen zu belassen.» (283)
Peterson entwickelt aus der Bibel eine klare Ordnung der Wesenszuschreibungen. Die biblischen Texte hätten eine deutliche Konzeption von der «Natur des Weiblichen» (109) bzw. des Männlichen. Schon die Reihenfolge der Schöpfung zeige dies. Es sei eindeutig Adam, den Gott mit der Aufgabe der Namensfindung für alle Tiere beauftragt habe. Dieses Einteilen und Ordnen der Welt sei «die Domäne Adams», des Mannes, und eben nicht der Frau.
Das Weibliche ist nicht zu solcher Weltgestaltung berufen, sie ist stärker dem Bereich der Fürsorge, der Empathie und Beziehungsgestaltung zugeordnet. Es sind nicht zufällig die Frauen, «die am häufigsten und verlässlichsten die Betreuung von schutzbedürftigen Kleinkindern übernehmen.» (96)
Peterson betreibt nicht im Ansatz so etwas wie eine historische Exegese, die Geschlechterkonzeptionen der Bibel oder auch der Antike mit heutigen vergleicht. Vielmehr sind für ihn die biblischen Beschreibungen Ausdruck natürlicher Wesenseigenschaften, die empirisch eindeutig und universal seien, inklusive gewisser Variationen. Beide Geschlechter seien durch je spezifische Eigenschaften und Stärken gekennzeichnet: «Bei der Frau ist es die Fähigkeit, Mitgefühl zu empfinden und zu versorgen (…) Im Falle des Mannes ist es die Leidenschaft, die Dinge der Welt zu verstehen und zu beherrschen.» (591)
Die Grundunterscheidung von Weltgestaltung bzw. Beziehungspflege zeige sich auch in der Sünde von Adam und Eva. Zwar könne man bei beiden von der klassischen Wurzelsünde des Stolzes reden. Beide verfehlen sich aber unterschiedlich. Bei Eva sei der «Narzissmus des Mitgefühls» (101) entscheidend. Ihre Stärke wird zu ihrer Schwäche.
«Mütterliches Mitgefühl ist der Geist des Weiblichen, der der einzelnen Frau verliehen ist.» (102)
Ihr Fehler sei der Versuch, grenzenlos mitfühlend und empathisch zu sein, selbst mit der Schlange bzw. der Stimme des Bösen. Es ist zwar so, dass «es in der bewundernswerten Natur des Weiblichen liegt, die Aufmerksamkeit des Männlichen auf das zu lenken, was verletzlich ist.» (109) Zur notwendigen Grenzziehung ist sie im Überschwang der Empathie aber nicht fähig. Adams Aufgabe wäre es gewesen, hier eine Grenze zu setzen. Aber sein Fehler sei die Anmassung, alles «beherrschen, benennen, unterwerfen und in die richtige Ordnung bringen zu können». (102) Diese Anmassung ist genauso irreführend wie die weibliche Illusion eines «allumfassenden Mitgefühls» (109).
Vertritt Peterson also tatsächlich eine reine Geschlechterideologie des 19. Jahrhunderts? Er ist in Diskussionen klug genug, diesen Vorwurf durch vermeintliche Differenzierungen abzuwehren, dass er nicht unmittelbar von konkreten Männern und Frauen redet, wenn er die Archetypen des Männlichen und Weiblichen anspricht. So kann er vereinzelt da, wo er von der Heldenreise des Mannes spricht, sagen: «Dasselbe gilt natürlich ebenso für Frauen.» (393)
Nur: Solche Bekenntnisse zur heutigen Gleichberechtigung der Geschlechter hängen in der Luft. Sein Geschlechterdenken bietet keinerlei Grundlage für die Annahme einer Gleichberechtigung der Geschlechter. Überall da, wo Peterson sich zur Gleichheit von Frauen und Männer bekennt, handelt es sich um Konzessionen an das heutige Denken, um Schutzbehauptungen, die die reaktionäre Logik seines Menschenbildes verschleiern sollen.
Was folgt aus dieser Geschlechterpolarität? Ausführlich bekennt sich Peterson zu konservativen Beziehungsidealen. «Langfristige monogame Beziehungen sind daher nicht nur die menschliche Norm, sondern auch das richtige Ideal, und zwar kulturübergreifend.» (338) Ein Grossteil der Menschheit richtet sein Leben daran aus. Die Differenz zu früheren Zeiten ist sehr viel weniger gross, als oft angenommen wird. Für Peterson steckt hinter allen anderen Lebensformen der «idiotische Hedonismus» (346) der Moderne.
Die sexuelle Revolution ist für Peterson eine katastrophale Entwicklung. Auch hier sind dem Schwarzmalen keine rhetorischen Grenzen gesetzt. Von dieser Entwicklung gilt, dass sie «alle Stabilität in Psyche und Gesellschaft gefährdet.» (344f.)
Diese normative Vorstellung der Geschlechter ist auch die Grundlage dafür, dass Peterson homosexuelle Orientierung oder Transidentität nicht als etwas Gleichwertiges oder Natürliches anerkennen kann. So sei es auch eine Folge der sexuellen Revolution, dass sie «den Aufstieg des Stolzes auf die sexuelle Identität zur wichtigsten öffentlich zur Schau gestellten Tugend ermöglicht – dabei ist er in Wirklichkeit die absolut tödlichste und grösste Sünde.» (345) Hätte der Vorwurf der Sünde nicht schon gereicht? Warum eine solche superlativistische Wendung? Letztlich zeigt diese groteske Zuspitzung, wie sehr Peterson inzwischen von diesem Thema umgetrieben ist.
Peterson bemerkt nicht mal die grundlegende Differenz, dass Stolz in der Bibel die Sünde ist, sich über andere zu erheben; Pride auf dem CSD hingegen eine Haltung derer ist, die von anderen abgewertet werden und öffentlich ihre Gleichwertigkeit feiern.
Für ihn geht es in seiner Kritik an queeren Lebensweisen und an Wokeism insgesamt um die Anerkennung einer normativen moralischen Ordnung. Diese könne nicht funktionieren ohne klare Unterscheidung zwischen Mitte und Rand der Gesellschaft. Es dürfe niemals zu einem «Aufstieg des Marginalen zur Norm oder zum Ideal» (90) kommen. «Ohne die Mitte kann nichts Bestand haben.» (526)
Es geht Peterson – und das mag man als gemässigt empfinden und das ist es vielleicht im Kontext der US-Rechten auch – nicht um eine Auslöschung des Randes. Es gäbe immer einen Bereich gesellschaftlicher Experimente mit neuen Lebensformen, so seine Überzeugung. Aber um so mehr gilt dann auch: «Der Rand, an seinem richtigen Platz, weist auf die Notwendigkeit und den Wert des Zentrums hin.» (528) Im Sinne seiner mythologischen Chaossymbole geht es weiter: «Das Monströse und die Aussenseiter haben ihren Platz, aber der ist nicht im Zentrum und kann es auch nie sein.» (Ebd.)
So warnt er vor einer «sträfliche(n) Vernachlässigung der wesentlichsten patriarchalischen Verantwortung. Wenn die wahre Gesellschaftsordnung entartet» – und die ist offensichtlich in irgendeinem positiven Sinne patriarchalisch – «dann muss die harte Hand des Autoritären herbei.» Oder ganz patriarchalisch formuliert: «Hedonistische Anarchie erfordert eine Regulierung durch den schrecklichen Vater» (507) Es könnte genau diese krude mythologische Logik sein, die Peterson zu einem radikalen Unterstützer Trumps macht.
Man dürfe sich hier nicht durch einen «falschen Egalitarismus» zum Mitgefühl mit den Menschen am Rande verführen lassen. Denn das «übermässige und meist falsche Mitgefühl mit denen, die die äusserste Dunkelheit der Welt bewohnen» sei «unentschuldbar» (532), weil es die Welt ins Chaos stürze.
5. Verfehlung der biblischen Botschaft
Die biblischen Texte bieten kein geschlossenes moralisches System. Noch viel weniger bietet die Bibel eine Handreichung zur Ordnung der Gesellschaft in der Moderne. Es gibt in der Bibel sehr unterschiedliche ethische Akzentsetzungen, die sich keineswegs auf eine autoritäre moralische Ordnung reduzieren lassen, wie Peterson das tut.
Peterson hat zunächst Recht mit der Beobachtung, dass man die biblischen Texte in die Logik anderer altorientalischer Überlieferungen einzeichnen kann. «Die rechtlichen Überlieferungen des Alten Testaments weisen eine grosse formale und inhaltliche Übereinstimmung mit denen ihrer altorientalischen Umwelt auf.» (Gertz, S. 233) Dazu gehört in historischer Sicht an vielen Stellen auch eine patriarchale Geschlechterlogik.
Gerade in der Tora wird diese Logik an vielen Stellen durchbrochen. Der Zürcher Professor für Altes Testament Konrad Schmid hat in seinem Vortrag Das Patriarchat als Strafe zuletzt noch einmal zusammengefasst, wo die Besonderheiten der biblischen Botschaft liegen.
- Gleichheit aller Menschen. Dass in Gen 1,27 alle Menschen als Ebenbild Gottes gelten ist im historischen Kontext revolutionär. In den grossen antiken Kulturen gibt es eine solche Gleichheitsidee nicht. Bild Gottes ist der König bzw. der Pharao. Der Monarch steht in einer Gottesbeziehung als alle anderen. Sodann ist die Unterscheidung von Freien und Versklavten für die gesamte historische Umwelt der Bibel wesentlich. Eine Schöpfungstheologie, die alle Menschen als Gleiche ansieht, ist revolutionär.
- Ebenbürtigkeit von Frauen und Männer. Wenn in dieser Schöpfungsaussage von Gen 1,27 hinzugefügt wird, dass alle Menschen gemeint sind, männlich wie weiblich, ist das eine Gleichheitszusage für Frauen, die historisch aussergewöhnlich ist. Die biblischen Texte stützen nicht nur nicht die Zuschreibung von bestimmten Wesenseigenschaften von männlich und weiblich im Sinne einer hierarchischen Ordnung. Die Pointe der Urgeschichte liegt gerade in der schöpfungsmässigen Gleichheit und Ebenbürtigkeit aller Menschen. Trotz der vielfältig patriarchalen Prägung der biblischen Autoren lässt sich diese Spur der Gleichheit durch die ganze Bibel verfolgen (Joel 3,1ff.; Gal 3,28)
- Patriarchat als Strafe. Dieser Logik entspricht es, wenn die Unterordnung der Frauen unter die Männer eine ganz besondere Deutung findet. «Dass ein jeder Mann der Herr in seinem Hause sei», wie es im Buch Esther (1,21) heisst, ist antike Normalität, die im Alten und im Neuen Testament vielfältig bezeugt wird. Wenn in Gen 3,16 die Herrschaft des Mannes über die Frau als Folgen der Sünde neben Mühsal und Schmerzen gestellt wir, wird deutlich, dass diese gesellschaftliche Normalität keine göttliche oder natürliche Ordnung ist, sondern ein Fluch, etwas Erlösungsbedürftiges.
In seinen Bibelauslegungen ist Peterson blind für solche befreienden Aspekte der biblischen Texte. Sein Versuch, die ganze Bibel für die göttliche Autorität einer natürlichen Hierarchie aller Lebensverhältnisse in Anspruch zu nehmen, wird der Bibel in keiner Weise gerecht.
Die biblischen Texte stehen quer zu einer solchen Logik des «gleichwertig, aber nicht gleichartig». Zum einen findet sich in der Bibel die Hierarchisierung starkes Geschlecht – schwaches Geschlecht (1Petr 3,7). Zum anderen werden vermeintlich typische Eigenschaften umgekehrt akzentuiert: Barmherzigkeit und Mitgefühl sind vielfach Eigenschaften von Männern bzw. Gottes des Vaters (Lk 15,11-32). Weisheit ist nicht nur im Buch Sprüche als Frau beschrieben (Spr 8); es gibt auch in den Erzähltexten jede Menge Beispiele für weise Frauen, wie Abigajl (1Sam 25), die Mutter Lemuels (Spr 31), die weise Frau von Tekoa (1Sam 14) oder die weise Frau von Abel-Beet-Maacha (2Sam 20).
Diese und viele Frauen sind in der Bibel nicht durch ihr grenzenloses Mitgefühl gekennzeichnet, sondern als weise Ratgeberinnen. Petersons Geschlechterdenken ist zutiefst geprägt von der aufgeklärten Romantik eines Rousseau, von Schiller oder Humboldt. Erst hier entsteht geschichtlich das moderne komplementäre Geschlechterdenken. Peterson reflektiert nicht ansatzweise das geschichtliche Gewordensein von Geschlechtervorstellungen. Hingegen arbeitet er sich kritisch an feministischen Positionen oder heutigen Gendertheorien ab. Es ist jedoch nicht zu erkennen, dass er sich mit den entsprechenden Theorien hinreichend vertraut gemacht hat.
6. Petersons Radikalisierung
Peterson hat sich im Laufe der Zeit immer stärker radikalisiert. In seinem 1999 erstmals erschienenen Werk Maps of Meaning sind viele der Grundentscheidungen seines psychologischen Denkens begründet. Im Vorwort beschreibt Peterson seine eigene Entwicklung. Nach einer behüteten Kindheit im christlichen Umfeld liess er als Jugendlicher seinen Glauben und diese Prägung hinter sich. Er schloss sich linken bzw. progressiven Bewegungen an. «Wirtschaftliche Ungerechtigkeit war meiner Meinung nach die Wurzel allen Übels.» (Peterson 2018, 11)
Auf dem College lernte er später eine Reihe von konservativen Menschen kennen, deren Lebensleistung ihm Respekt abnötigte. So sei es bei ihm zu einer Umorientierung gekommen. Die sozialistische Philosophie verlor für ihn jeden humanistischen Anschein. «Die sozialistische Ideologie diente dazu, Ressentiments und Hass zu verschleiern, die durch das eigene Versagen verursacht wurden.» (A.a.O., 12) Im Rückblick ist Peterson überzeugt, dass die meisten Aktivisten für soziale Gerechtigkeit solche Ideale nur propagieren, um ihren Neid bzw. ihre Abneigung gegenüber erfolgreichen Menschen zu verbergen.
In der grundsätzlichen Beschäftigung mit dem Phänomen der Ideologie kommt er später noch einen Schritt weiter. «Nicht die sozialistische Ideologie war also das Problem, sondern die Ideologie als solche. Ideologie teilt die Welt stark vereinfachend in diejenigen, die richtig dachten und handelten und diejenigen, die es nicht taten.» (Ebd.)
Aus einer solchen liberal-konservativen Haltung heraus setzte sich Peterson mit den Ideologien des 20. Jahrhunderts von rechts und von links auseinander. Dabei ist seine Darstellung von der Wahrnehmung der jeweils spezifischen Gefährdung konservativer und progressiver Einstellungen bestimmt. Peterson ist davon überzeugt, dass jede gute politische Führung das Zusammenspiel des Beständigen und des Wandels leisten müsse.
«Schreckliche, chaotische Kräfte lauern hinter den Fassaden der normalen Welt. Diese Kräfte werden durch das Aufrechterhalten der sozialen Ordnung in Schach gehalten. Aber die Herrschaft der Ordnung ist ungenügend, denn die Ordnung selbst wird erdrückend und tödlich, wenn man ihr erlaubt, unkontrolliert oder ununterbrochen zu herrschen.» (A.a.O., 134) Die Herausforderung sei es, nach Vermittlung zu streben, so dass «das Neuartige erträglich und die Sicherheit flexibel bleibt.» (A.a.O., 135)
Die Gefährdung des Konservatismus liegt in der Versuchung, jeden Wandel verhindern zu wollen: «Extremer Konservatismus versucht, Unsicherheiten und den Ausbruch des Unbekannten zu verhindern.» (A.a.O., 438) Problematisch sei der einseitige «Ruf nach Rückkehr zu den guten alten Zeiten», verbunden mit dem Versuch, alle Abweichungen zu unterdrücken. Ausdrücklich benennt er diese Fehlentwicklung als Bedrohung des «Faschismus». Damals ist Peterson überzeugt: «Eine absolut konservative Gesellschaft kann nicht überleben, denn die Zukunft überschreitet die Begrenzungen der Vergangenheit.» (431) Wo hingegen linke Weltverbesserung mit allen moralischen und institutionellen Überlieferungen bricht, entstehe unter dem Vorwand progressiver Befreiung eine selbstsüchtige Kultur, die keine Grenzen der persönlichen Freiheit mehr akzeptieren will.
Was in Maps of Meaning noch in einer gewissen Balance vorliegt, ist im Laufe der Zeit und nun im Buch über Gott stark in eine Richtung gekippt. In einer Zeit, wo die Mehrheit der Menschheit längst in autoritären Staatsformen lebt und auch im Westen rechte Parteien immer stärker werden, sieht Peterson offensichtlich die Gefahr weit überwiegend nur auf einer Seite: Der Feind steht links. Ansatzweise weiss Peterson noch von seinen früheren Einsichten, dass es kein Leben ohne Wandel gibt. Aber er ist unfähig, auf progressiver Seite zumindest noch richtige Anliegen im Übertreibungsmodus wahrzunehmen.
Konnte man Peterson früher noch als liberal-konservativ wahrnehmen, so ist er inzwischen fest in rechten und radikalen Netzwerken verankert. Sein kulturkämpferischer Stil zeigt dies vielfältig.
- Keine Auseinandersetzungen mit konkreten Positionen. Es finden sich viele Anspielungen auf soziale Bewegungen für Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit, Feminismus oder Inklusion. Diese Gruppierungen bleiben ein Schema. Sie werden gedeutet als «Nachahmung Kains» (156), als Haltung, die aus Neid und Opfermentalität zusammengesetzt.
- Keine differenzierte Problemanalyse. In keiner Frage ist Peterson in der Lage, die komplexen Debatten der Gegenwart zu Gender, Migration oder Klima auch nur anzudeuten. Die Darstellung ist von einem Freund/Feind-Szenario bestimmt. Menschen, die sich für soziale Gerechtigkeit oder Umweltschutz aussprechen, unterstellt er Neid oder «Hass auf die Menschheit» (585)
- Aggressive Polemik. Vielfach gebraucht Peterson eine aggressive Sprache, die Andersdenkende als idiotisch und gefährlich brandmarkt. Bibelauslegungen, die postkoloniale Perspektiven aufgreifen, bezeichnet er als «eigennützigen, überheblichen, erbärmlichen Unsinn» (A.a.O., 625.)
- Unterkomplexes Wissenschaftsverständnis. Peterson ist vielfach darauf hingewiesen worden, dass sein Versuch, Geschlechterverhältnisse aus der Biologie abzuleiten, auch naturwissenschaftlich nicht überzeugen kann. Die für das Menschsein unentrinnbare Verwobenheit biologischer und kultureller Faktoren wird nicht ernstgenommen. Nicht mal im Ansatz bezieht er sich auf die kulturelle Geschlechtergeschichte des westlichen Kulturkreises, geschweige denn eines anderen.
Peterson befriedigt das Bedürfnis derer, die nach Sicherheit suchen und klare Antworten wollen. Es dürfte das Drama dieses Denkers sein, dass er einst wusste, was eine liberal-konservativ Haltung sein könnte, aber diese ausgleichende Einstellung im Kulturkrieg unserer Zeit über Bord geworfen hat. In dieser Perspektive wird leider auch die Bibel kaum mehr als Quelle der Wahrheit und Wegweiser zur Gerechtigkeit gelesen – sondern als Waffe im Kulturkampf genutzt.
Literatur
Gertz, Jan Christian (Hg.) (62019): Grundinformation Altes Testament: Eine Einführung in Literatur, Religion und Geschichte des Alten Testaments. (Utb), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Peterson, Jordan (2018): Warum wir denken, was wir denken: Wie unsere Überzeugungen und Mythen entstehen. Die deutsche Erstausgabe von «Maps of Meaning». München: mvg Verlag.
Peterson, Jordan (2019): 12 Rules for Life. Ordnung und Struktur in einer chaotischen Welt. München: Goldmann.
Peterson, Jordan (2024): Gott. Das Ringen mit einem, der über allem steht. Wie die Archetypen des Alten Testaments unseren Glauben prägen und was sie uns heute zu sagen haben. Basel: Fontis Verlag.
Podcast Geist.Zeit: Wer ist der Gott von Jordan Peterson?
Thorsten Dietz (2025): Wer ist Jordan Peterson?
Bilder:
Stocksnap auf Pixabay (pixabay.com/de/photos/heilig-buchen-bibel-lesen-religion-2561029/)
Gage Skidmore, Wikipedia.