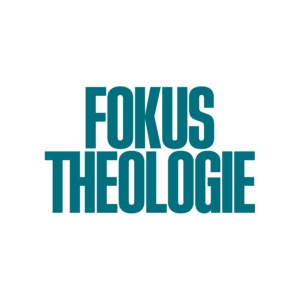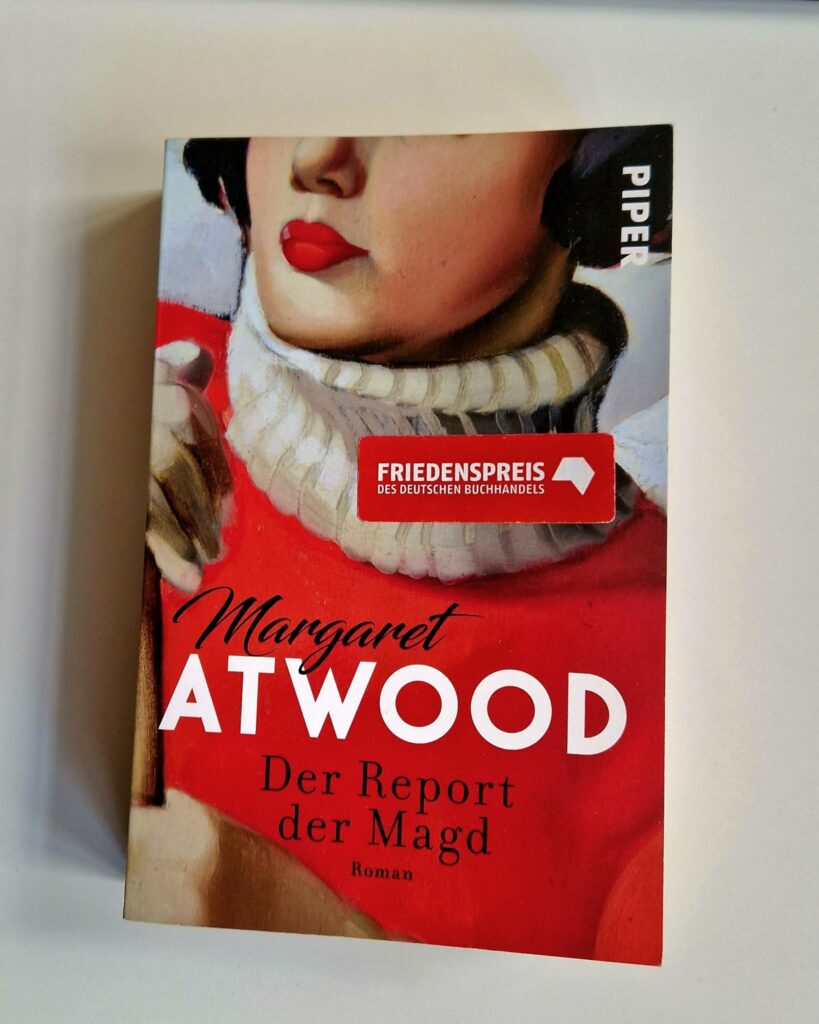Im Frühjahr 2025 erscheint die 6. Staffel von «The Handmaid’s Tale«, eine Geschichte auf Grundlage des Romans «Der Report der Magd von Margret Atwood von 1985. Die aktuellen Entwicklungen in den USA lassen den Roman von Margret Atwood und die Serie dazu heute prophetischer denn je erscheinen.
Im Rahmen unserer Auslegung der Jahreslosung 2023 «Du bist ein Gott, der mich sieht» Gen 16,13 haben wir auch einen Seitenblick auf diese Serie eingefügt. Denn die Geschichte von June Osborne hat eine Reihe von Berührungspunkten mit der biblischen Geschichte von Hagar, der dieser Vers entnommen ist. Anlässlich der Ausstrahlung der letzten Staffel von The Handmaid’s Tale veröffentlichen wir dieses Kapitel daher noch einmal als eigenen Beitrag.
In Hagars Spuren
Im Mittelpunkt von «The Handmaid`s Tale» steht die Geschichte von June Osborne. June wurde nicht in Gilead geboren. Sie hat die Revolution miterlebt, sie kennt noch die Welt, in der Frauen gleichberechtigte Menschen waren. Da June zu den noch gebärfähigen Frauen gehört, ist ihr Weg in Gilead vorgezeichnet. Das Regime nimmt ihr das eigene Kind weg und macht sie zu einer «Magd». Vielfach nimmt die Erzählung Mass an der Figur Hagars. Die Mägde haben Geschlechtsverkehr mit den Herren der Familie. Die Geburt findet statt auf dem Schoss der rechtmässig angetrauten Ehefrauen. Bis ins Detail hinein werden Züge der Hagar-Geschichte kopiert.
- Wie in der biblischen Geschichte passiert es auch hier: In der Regel werden die Mägde nicht mit ihrem Namen genannt. Sie sind Mägde, die man nach ihren Herren benennt. Heisst dieser Fred, so lautet der Name Offred.
- June Osborne beschreibt, wie sehr die Frauen auf eine reine Funktion reduziert werden. «Wir dienen zu Fortpflanzungszwecken. Wir sind keine Konkubinen. (…) Wir sind zweibeinige Gebärmütter, mehr nicht.» (Atwood 2017, 185)
- Wie Hagar weigert sich auch June, alles mit sich machen zu lassen. Im Unterschied zu Hagar ist sie aber nicht allein. Immer mehr Frauen wollen sich diese Unterdrückung nicht mehr gefallen lassen. Das Verlangen nach Freiheit ist unauslöschlich.
- Und das Bemerkenswerte: Auch June lässt sich Gott nicht wegnehmen. Auch das verbindet sie mit ihrem biblischen Vorbild Hagar.
June lässt sich Gott nicht wegnehmen
Ausführlich schildert der Roman, wie Gebete zum Mittel geistlicher Disziplinierung gemacht werden. Unentwegt wird Beten erzwungen, als Mittel einer geistigen Selbstauslöschung. Inmitten ihrer Widerstands- und Fluchtpläne beschliesst June: «Heute Abend will ich meine Gebete sprechen.» (Atwood 2017, 261)
Doch wie macht man das? June nimmt Maß am Unser Vater. Und sie verbindet dessen Worte mit je eigenen Gedanken. Diese sind weitaus weniger salbungsvoll und gewissheitsschwer als das Original. Gottes Namen heiligen? «Ich wünschte, Du sagtest mir Deinen Namen, den wahren, meine ich.» (Atwood 2017, 262)
Denn an einer Sache lässt June in ihrem Gespräch mit Gott keinen Zweifel: «Ich glaube nicht eine Sekunde lang, dass das, was da draussen vor sich geht, so von Dir gemeint war.» (Ebd.) Und man wünschte, dass diese Gewissheit überall stark wäre, wo heute religiöse Fanatiker glauben, mit dem Namen Gottes ihre eigene Intoleranz und Engstirnigkeit rechtfertigen zu können.
Das tägliche Brot sei kein Problem, erklärt sie Gott. «Das Problem ist, es hinunterzuwürgen, ohne daran zu ersticken.» (Ebd.) Am ausführlichsten wird ihr Gebet da, wo es um Vergebung und Versuchung, Böses und Leiden geht. Bevor an so etwas wie Vergebung zu denken wäre, bittet June für die vielen Opfer vergangener und künftiger Verbrechen. «Lass sie nicht zu sehr leiden.» (Ebd.) Und dann erst stellt sich June dem eigentlichen Text, aber in Freiheit und Wahrhaftigkeit: «Ich nehme an, ich müsste jetzt sagen, dass ich all denen vergebe, die dies angerichtet haben (…) Ich will mir Mühe geben, aber es ist nicht leicht.» (Ebd.)
June arbeitet sich durch die Gedanken der Erlösung, der Hoffnung auf Reich, Kraft und Herrlichkeit. Sie versucht es. Sie schliesst nicht mit einem Amen, sondern mit Fragezeichen: «Ich komme mir so vor, als spräche ich zu einer Wand. Ich wünschte, du würdest antworten. Ich bin so allein. (…) O Gott, o Gott. Wie soll ich weiterleben?»
In der alten, freien Welt lebte June ein säkulares Leben, in dem Gebet keine Rolle spielte. Für viele mag dies gegen das Beten als solches sprechen, dass es manchmal erst am Abgrund einleuchtet. Aber das könnte auch seine besondere Stärke sein: Worte, Gesten und eine Sprechrichtung zu haben, in denen letzte Wünsche, Verzweiflung und Hoffnung einen Ausdruck finden können. Wenn man einem übermächtigen System gegenüber dem eigenen Gewissen folgen will, werden solche Fragen zentral: Sind Wahrheit und Gerechtigkeit nur täuschende Worte, hinter denen sich die Mächtigen je nach Gutdünken verstecken können?
Gibt es so etwas wie eine begründete Hoffnung darauf, dass Lügen nicht endlos funktionieren, dass auf lange Sicht Gerechtigkeit triumphieren wird, dass Güte nicht ohnmächtig, sondern machtvoll ist?
Gott oder Freiheit?
Der Appell an die Macht Gottes inmitten der Ohnmacht, das ist die Ursituation der biblischen Rettungsgeschichten.
June Osborne ist eine moderne Hagar.
Eine Magd (Handmaid), die nicht mehr gehorchen will und kann. Eine Magd, die aufbegehrt gegen jede soziale oder religiöse Ordnung der Unterdrückung; und die gerade darin Gott findet.
Als Margaret Atwood ihren Roman The Handmaid’s Tale schrieb, war sie tief erschüttert über die Revolution im Iran (1979). Der vorrevolutionäre Iran war weit davon entfernt, eine Demokratie zu sein. Aber dass ein breiter gesellschaftlicher Aufruhr gegen die Alleinherrschaft des Schahs schliesslich von einer ultrakonservativen Elite schiitischer Religionsgelehrter übernommen werden würde, dass ein religiöser Wächterrat zum eigentlichen Machtzentrum dieses Landes würde, dass dieser das Leben der Frauen in erheblichem Masse aus der Öffentlichkeit verbannen würde, all das schien Atwood noch wenige Jahre zuvor schier unvorstellbar.
Den gleichzeitigen Anfangserfolgen der christlichen Rechten in den USA wollte damals niemand langfristigen Einfluss zutrauen. Aber hatte die Geschichte des Iran nicht gezeigt, wie schnell es in chaotischen Zeiten gehen kann?
Aus gegenwärtiger Sicht muss man sagen: Margaret Atwoods Roman The Handmaid’s Tale hat heute jeden Anschein des Radikalen verloren. Niemand kann heute ernsthaft daran zweifeln, dass religiöse Extremisten zu radikalen Veränderungen der Gesellschaft bereit sind, egal auf welche Heilige Schrift sie sich berufen.
Man kann eine solche Serie als mehr oder minder explizite Religionskritik verstehen. Hütet euch vor dem Gebetseifer und der Schriftversessenheit der radikalen Frommen. Ihre Bekenntnisse zur wortwörtlichen Schrifttreue sind ernst zu nehmen. Wenn sie die Möglichkeit haben, werden sie die Alpträume ihrer religiösen Urkunden zu neuem Leben erwecken. Es hätte nahe gelegen, diese Idee zu einer komplett antireligiösen Schreckensgeschichte auszubauen. Darum ist es so bemerkenswert, dass es nicht geschehen ist.
Mehr als Schwarz und Weiss
Es gibt mehr als Schwarz und Weiss. Muss man sich entscheiden, ob man am christlichen Glauben festhält oder an den Befreiungsgeschichten der Moderne? Ist der Gegensatz unüberbrückbar geworden zwischen der Freiheit des Einzelnen und dem Glauben an den einen Gott? Für viele scheint das ausgemacht. Auf beiden Seiten. Freiheit, so die einen, kann nur errungen werden im Auszug aus den monotheistischen Religionen der letzten Jahrtausende. Sie haben Macht und Männlichkeit Gottes in einer Weise verschraubt, die sich nicht mehr auflösen lässt.
Gott wurde nicht nur zutiefst männlich gedacht; dadurch wurde auch das Männliche mit göttlicher Aura ausgestattet. Für die anderen ist dieses Streben nach Freiheit Inbegriff dessen, was Sünde ausmacht: Der autonome Mensch, der sich von Gott lossagt, wird auch sonst keine Autoritäten und Traditionen respektieren können. Was als Freiheit beginnt, wird in Einsamkeit enden.
Hagar widerlegt diese schiefen Alternativen mit einem Satz. «Du bist ein Gott, der mich sieht.»
Der Gott, der als Gott der Väter angerufen wird, ist auch der Gott einer entflohenen Sklavin.
Und das Bemerkenswerte ist ja, wie gesehen: Die Flucht der Sklavin in die Wüste ist ein Vorspiel zu Israels Grunderfahrung. In der Herausführung der Unterdrückten aus Ägypten zeigt der biblische Gott, dass er den entlaufenen Sklaven nähersteht als den grossen Tempeln des Pharaos.
Und die Hagar-Geschichte gibt dieser Befreiungserzählung eine unerwartete Wendung. Es ist ausgerechnet die Familie von Sara und Abraham, der Erzeltern des Glaubens, die zum Ort der Unterdrückung wird. Keine Erwählung und kein Segen schützen davor, dass die Gemeinschaften des Glaubens zum Ort der Unterdrückung werden können.
Dass Glaubensgemeinschaften zur Hölle auf Erden werden können, ist leider für viele nichts Ungewöhnliches. Vielen ist aber unbekannt, dass eine solche Erfahrung in der Heiligen Schrift der jüdischen und christlichen Gläubigen ausdrücklich beschrieben wird.
Die biblischen Texte wissen darum, dass selbst die grössten Vorbilder des Glaubens für andere eine tiefe Enttäuschung werden können. Hagar in der Bibel – das ist ein Monument der Selbstkritik, ein Symbol für die Fehlbarkeit aller Menschen, nicht zuletzt auch der frommen.
Hagar in der Bibel, das ist zugleich die Erinnerung: Gott gehört nicht denen, die sich am lautesten auf ihn berufen. Sein Segen folgt nicht nur denen, die ihn ausdrücklich darum bitten. Sein Segen kann auch denjenigen folgen, die die von ihm erwählten Gemeinschaften verlassen. Seine Verheissung des Lebens holt auch diejenigen ein, die in den Wüsten ihres Lebens nur noch den Tod erwarten.
Literatur
Atwood, Margaret: Der Report der Magd, München 2020 (1985). (The Handmaid’s Tale)
Atwood, Margaret: Die Zeuginnen. Berlin Verlag 2019. Die Fortsetzung des Romans The Handmaid’s Tale, die ebenfalls Grundlage einer Verfilmung als Serie werden wird.
Zur aktuellen Entwicklung in den USA vgl. aus theologischer Perspektive auch die Podcast-Folge: Der christliche Nationalismus von «Das Wort und das Fleisch»
Vgl. auch die Podcast-Folge von Geist.Zeit: Die Anfänge der feministischen Theologie