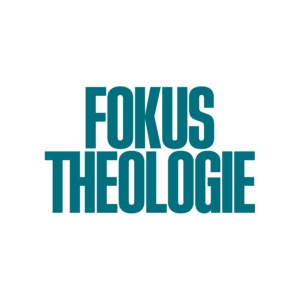Dieser Beitrag ist Teil unseres Jesus Dossiers.
1. Ein Kreuz – viele Worte – grosses Rätsel
Was geschah eigentlich damals an Karfreitag, als Jesus von Nazareth gekreuzigt wurde? Kann, soll oder muss dieses weit zurückliegende Ereignis noch eine Rolle für den christlichen Glauben spielen? Und wenn ja, wo liegen Bedeutung und Sinn des Kreuzes Jesu heute?
Die Antworten auf diese schlichten Fragen sind so vielfältig, dass man den Überblick verliert. Und das war schon immer so.
Der Kreuzestod Jesu ist ein Ereignis, das seit rund zweitausend Jahren ziemlich viele der Reaktionen triggert, die uns Menschen möglich sind.
Eine grobe Einteilung könnte so aussehen:
a) Von Gleichgültigkeit bis Apathie
Schulterzucken damals
Vielleicht war Schulterzucken schon immer die häufigste Reaktion auf die Ereignisse, die sich auf dem Hügel Golgotha zugetragen haben. Die Hinrichtungsstätte lag ausserhalb der Stadt Jerusalem, wie sie von Herodes dem Grossen gestaltet worden war. Aber immer noch stadtnah genug, um die Menschen abzuschrecken, sich gegen die geltende Ordnung und Obrigkeit aufzulehnen.
Viele wurden damals gekreuzigt. Auf einen mehr oder weniger kam es nicht an.
Und selbst wenn bekannt war, dass Jesus von Nazareth Opfer ungerechter religiös-politischer Prozesse war, dann konnte man das als bedauerlich zur Kenntnis nehmen und rasch wieder ablegen.
Indifferenz heute
Bis heute hat der Tod Jesu für die meisten Menschen keine besondere Bedeutung. Freilich flammt die Diskussion um das Kreuz Jesu Christi immer mal wieder auf. Etwa wenn besorgte Eltern gerichtlich gegen die Kruzifixe in Klassenzimmern vorgehen. Sicherlich ist das Kreuz als Symbol und auch als Schmuckstück kulturell allgegenwärtig. Und auch über das freie Osterwochenende freut man sich.
Aber dass Jesus gestorben ist, geht an den meisten vorbei. Ein tausendfach verjährtes Ereignis, das nur noch wenige berührt. Eine Apathie, in der der Anlass für Karfreitag vergessen gegangen ist.
b) Von Spott bis Anklage
Das berühmte Spottkruzifix
1856 entdeckten Forscher auf dem Palatin, einem der sieben Hügel Roms, eine Ritzzeichnung vom Anfang des 3. Jahrhunderts. Verspottet wird darauf ein Alexamenos, der eine gekreuzigte Figur mit Eselskopf anbetet. Schon Paulus kannte das Kopfschütteln derer, die es als peinlich, dumm und erbärmlich empfanden, die Kreuzigung Jesu als heilsstiftendes Handeln Gottes zu verstehen (1Kor 1,18-25).
Folgenschwerer Geburtsfehler
Aus Spott kann bissige Ablehnung werden. Im Laufe der Jahrhunderte ist durchgängig Kritik daran geübt worden, den brutalen Tod Jesu mit dem Heil der Menschen und ihrer Welt in Verbindung zu bringen.
Weil in der Mitte des christlichen Glaubens ein Gewaltakt stehe, entsprängen dort Legitimation und Verherrlichung von Gewalt.
Für Kritiker wie den 2024 verstorbenen Philosophen Herbert Schnädelbach gehört der Kreuzestod Jesu zu den Geburtsfehlern des Christentums, der nicht nur zu «Blutorgien» in Kreuzesliedern, sondern zu echten Gewaltgräueln im Namen Christi geführt hat.
c) Von Glauben bis Streiten
Frühchristliche Interpretationsleistung
Es brauchte schon ein hohes Mass an Ergriffenheit, Begeisterung und Kreativität, um den Tod Jesu als Ereignis zu interpretieren, aus dem positive Wirkungen hervorgegangen sind (Heilstod). Da galt man in der Antike schnell als Verrückte, als «kakodaimones», wie Lukian von Samosata die Christen im zweiten Jahrhundert ausgrenzt. Und man stand in der Gefahr, selbst verfolgt zu werden und die eigene Kreuzigung in Kauf zu nehmen.
Konstantinische Wende
Bis aus dem Aussenseiterzeichen ein Sieges- und Herrscherzeichen wurde. Kaiser Konstantin erblickte das Kreuz vor der Schlacht auf der Milvischen Brücke (312). In den kommenden Jahrzehnten wurde das Christentum zur Staatsreligion erhoben.
Mit der kulturellen Stellung der Kirche veränderte sich auch die Deutung des Kreuzes Jesu. Es wurde je länger, je mehr interpretiert innerhalb der grossen Triumphgeschichte Gottes.
Etwa als Sieg Gottes über alle lebensverderbenden Mächte und Feinde. Oder als Handeln, durch das Gott die gerechte, lebensförderliche Ordnung innerhalb der Gesellschaft wiederherstellt.
Verbindliche und stabilisierende Kreuzeslehre
Das Kreuz wurde so inkulturiert, dass es eine stabilisierende Funktion für die Reichskirche und die Gesellschaft entfalten konnte. Und dazu brauchte es eine einheitliche, verbindliche Lehre vom Kreuz, die es so weder in der Bibel noch in den ersten Jahrhunderten der Alten Kirche gegeben hatte.
Streitbare Kontextualisierungen
Die Leidenschaft, den Kreuzestod Jesu in sich verändernden kulturellen Kontexten zu denken und zu kommunizieren, prägt die Christenheit bis heute. Und genau das ist einer der Gründe dafür, dass der Streit um eine situationsgemässe Interpretation des Kreuzestodes Jesu bis heute andauert.
Die unüberschaubare Fülle an Theologien lässt sich kaum bändigen und ist mühsam. Aber sollten wir uns angesichts allgemeiner Kreuzesapathie nicht über jeden Streit um das Kreuz freuen?
- Etliche sehen kaum noch Möglichkeiten, das Kreuz Christi in einer spätmodernen Kultur plausibel zu machen. Sie erleben und kommunizieren es als befreiend, nicht mehr glauben zu müssen, dass Jesus für uns Menschen gestorben sei.
- Andere bringen Jesus und sein Kreuz als ethisches Vorbild der Liebe ins Spiel, dem es nachzueifern gilt.
- Wieder andere arbeiten an neuen Zugängen zu den fremdgewordenen Konzepten von Opfer, Sühne und Stellvertretung und hoffen, dadurch in Resonanz gehen zu können mit den Erfahrungen, die Menschen heute machen.
- Und manche halten an einer vermeintlich biblischen und verbindlichen Lehre von Sünde, Gerechtigkeit, Strafe, Sühnopfer fest. Dass diese heute als unglaubwürdig erfahren wird, erklärt man mit dem Hinweis, das Kreuz Christi sei von Anfang an ärgerlich und anstössig gewesen.
d) Was machen wir mit dem KreuzWortRätsel?
Von Anfang an provozierte das Kreuz Christi eine rätselhafte und widersprüchliche Vielfalt an Deutungen. Wir wollen dieses KreuzWortRätsel besser kennenlernen und uns ein wenig daran probieren. Es gibt nämlich Geheimnisse, die zwar nie gelüftet werden, in denen man jedoch daheim sein kann. Aber dazu muss man wenigstens eine Ahnung haben, in welcher Geheimnishaftigkeit man sich bewegt.
Es gibt Steine des Anstosses, die besser nicht rumliegen, sondern erneut ins Rollen gebracht werden.
Deshalb stellen wir uns in zwei Basistexten folgenden Fragen:
- Wie haben die urchristlichen Gemeinden den Tod Jesu gedeutet? Was können wir aus den Deutungen des Neuen Testaments für unsere Frage nach dem Kreuzestod Christi heute lernen?
- Welche theologischen Modelle haben sich für die Kirche bewährt, wenn sie in der Antike, im Mittelalter, zur Reformation und bis zur Neuzeit versucht hat, die Botschaft vom Kreuz Christi zu kontextualisieren und zu kommunizieren?
- Welche Möglichkeiten eröffnen sich angesichts der (spät)modernen Kritik klassischer Kreuzeslehren für eine zeit- und situationsgemässe Vorstellung vom Kreuzestod Jesu?
2. «Christus ist auferstanden – jetzt haben wir ein Problem!»
Darum geht es in diesem Abschnitt: Warum und wie genau war die nachösterliche Christenheit herausgefordert, den Tod Jesu zu deuten? Wie hat die Urgemeinde diese Herausforderung gemeistert?
a) Ohne Auferstehung kein Wort vom Kreuz
Unser Ostern-Dossier fängt mit zwei Basistexten über die Auferstehung Jesu an. Dass wir die chronologische Reihenfolge durchbrechen, hat einen guten Grund:
Wäre Jesus nicht auferstanden und den Menschen erschienen, wäre niemand auf die Idee gekommen, sich um ein positives Verständnis seines Sterbens zu bemühen.
Was für die meisten Zeitgenoss:innen damals bedeutungslos sein mochte, war für seine Anhänger:innen nicht nur eine bittere Enttäuschung, sondern eine Katastrophe. Desillusioniert und verängstigt flüchteten sie oder versteckten sich (Lk 24,21; Mk 14,50; Joh 16,32). Die Jesus-Bewegung hätte sich wohl zerstreut.
Die Auferstehung ruft nach Erklärungsversuchen
Doch dann erschien der Gekreuzigte unterschiedlichen Menschen, und die erzählten das weiter.
Die Osterereignisse sind die Initialzündung für die Entstehung des Glaubens in der Urgemeinde.
Aber nicht in dem Sinne, dass nun eine kollektive Erleichterung einsetzte und alles – auch der unverständliche Tod Jesu – klar war. Im Gegenteil: Wenn Gott sich in der Auferweckung Jesu zu ihm bekannt, ihn ins Recht gesetzt und als Christus und Herrn eingesetzt hat (Röm 1,4), dann bedarf sein Kreuzestod einer ernsthaften, theologischen Erklärung.
«Wie sollte man an einen glauben, der als gemeiner Verbrecher, ja – in jüdischen Kategorien – als Gesetzesbrecher und Verführer hingerichtet worden war und für einen torakundigen Juden als von Gott Verfluchter gelten musste (Dtn 21,23; vgl. Gal 3,13)?» (Frey 2012, 46).
Wie lässt sich das Unfassbare fassen?
Welche Hilfsmittel standen den ersten Christen zur Verfügung, um mit den chaotischen Ereignissen rund um Jesu Kreuzigung klarzukommen? Welche Ressourcen konnten sie anzapfen, um Jesu absurden Tod so zu interpretieren, dass er zu den Ostererfahrungen und dem Bekenntnis passte: Jesus ist der von Gott auferweckte Christus? Diese traditionsgeschichtliche Fragestellung bringt uns zwei Schritte weiter.
b) Sich zu einer Erzählgemeinschaft versammeln
Was zunächst chaotisch und verstörend erlebt worden war, wurde gemeinsam gesammelt, sortiert, rekonstruiert und nacherzählt. Deshalb gibt es die Evangelien des Neuen Testamentes. Sie erzählen eine dramatische Geschichte, in der die Kreuzigung Jesu vom Umfang aber auch von der Bedeutung her im Zentrum steht. Geschichtliche Ereignisse werden interpretierend wiedergegeben, damit in ihnen das sinnvolle, weil heilsstiftende Handeln Gottes erkennbar wird.
So bildete sich eine erzählende Gemeinschaft, die dem Kreuzestod Jesu einen Sinn zuschreiben konnte, der sich aus dem Ereignis an sich nicht ergeben hatte.
Erzählend Sinn stiften
Das an sich sinnlose Ereignis bekommt durch die Erzählung Sinn. Dies zeigt sich auch darin, dass es öfters heisst, «der Menschensohn» müsse leiden und verworfen werden (Mk 8,31; Lk 17,25). Anscheinend hat Jesus den enttäuschten Jüngern auf dem Weg nach Emmaus die Geschichte Gottes mit den Menschen so erzählt, dass sein Sterben als von Gott gesetztes, sinnvolles, ja, notwendiges Ereignis darin erschliessbar wird (Lk 24, 7.26.44-46).
c) Bilder von woanders her sammeln
Was uns hier nun aber vor allem interessiert, ist die Art und Weise, wie die ersten Christen den Tod Jesu mittels unterschiedlicher Bilder gedeutet haben. Sie taten das aus gutem Grund:
Jesus selbst hat keine theologische Deutung seines Todes gegeben. Eher kryptisch sind seine Worte über die eigene Taufe (Lk 12,50) oder seine Selbsthingabe als Lösegeld (Mk 10,45). Auch die Schriften und Traditionen Israels konnten keine Erklärung für Jesu Kreuzestod bieten.
Sind Bilder und Metaphern nicht zu schwammig?
Bevor wir ein wenig durch die Bildergalerie des Neuen Testaments streifen, empfiehlt sich ein Blick auf die Art und Weise, wie Sprache funktioniert. Denn wir sind ja hier in unserem KreuzWortRätsel durchaus an einer Sprache interessiert, mit der sich die Bedeutung des Kreuzes Christi angemessen verstehen und kommunizieren lässt.
Aber sind Bilder und Metaphern da nicht viel zu unpräzise, diffus und uneigentlich? Brauchen wir nicht einen umweglosen, direkten Weg, auf dem wir über Karfreitag sprechen? Worte, die – ähnlich wie ein Foto – eindeutig und direkt spiegeln, was sie beschreiben?
Worte und Wirklichkeit
Grob gesagt benutzen wir ständig bildhafte Sprache, um unsere Welt zu verstehen und zu beschreiben. Oft ist uns das aber nicht bewusst. Etwa wenn die Physiotherapeutin zum Patienten sagt: «Der Muskel ist enorm verspannt.» Das ist direkte, eigentliche Sprache, oder doch nicht? Denn das Wort «Muskel» kommt ursprünglich von lat. «musculus», was «kleine Maus» bedeutet.
Irgendwann kam jemand auf die Idee und wendete das Wort «musculus» in einem neuen und ungewöhnlichen Bereich an: Kontraktionen sehen aus, als ob eine kleine Maus unter der Haut läuft.
Die Übertragung machte für die Menschen Sinn. Die Metapher war so erfolgreich, dass sie mit der Zeit gar nicht mehr als metaphorisch empfunden worden ist.
Metaphern sind Sprache in höchster Aktion
Gerade bei Phänomenen, Ereignissen oder Wirklichkeitsbereichen, die sich uns erst mal nicht erschliessen und unzugänglich bleiben, hilft uns die metaphorische Arbeitsweise. Damit haben sich auch die Urchrist:innen das Kreuz Jesu erschlossen. Sie haben Worte und Konzepte aus einem bildspendenden Bereich genommen und auf einen bildempfangenden Bereich – den Kreuzestod Jesu – übertragen. Dadurch bekam das Sterben Jesu Sinn und Bedeutung. Wir wollen uns diesen kreativen Prozess und die gewonnen Erkenntnisse skizzenhaft anschauen.
3. Deutungsbilder aus der Galerie des Neuen Testaments
Darum geht es in diesem Abschnitt: Mit welchen Bildern und Metaphern haben die Urchristen versucht, das Kreuz Christi zu deuten und zu erschliessen? Und – salopp gefragt – was kam dabei raus? Was war es, was sich erschlossen hat?
Die Unfassbarkeit des Kreuzestodes Jesu zeigt sich darin, dass es im Neuen Testament weder eine einheitliche Lehre vom Kreuz gibt noch ein einziges Bild, mit dem die Sinn- und Deutungspotenziale dieses Ereignisses ausgeschöpft werden könnten. Es gibt noch nicht einmal eine Diskussion darüber, welche Metapher nun die beste und dominierende sein sollte.
a) Bilder aus dem Bereich des Kultes
Häufig deutet das Neue Testament den Tod Jesu mit Hilfe von Elementen, die den Menschen damals aus der kultischen Opferpraxis bekannt waren.
Die reinigende und sündenbeseitigende Wirkung des Blutes wird auf Jesus übertragen (Mk 14,24; Röm 5,9). Aber auch die schützende Wirkung: Der Gekreuzigte wird – nicht zuletzt auch, weil er am Passafest stirbt – interpretiert auf dem Hintergrund des geschlachteten Passalamms, dessen Blut vor dem Bösen bewahrt (Joh 1,29; 1Kor 5,7).
In Analogie zur Kapporät – der Sühneplatte über der Bundeslade im Allerheiligsten des Tempels – wird der Kreuzestod Jesu als Aufhebung der Distanz zwischen Gott und Mensch gedeutet (Röm 3,25). Einmal im Jahr, am grossen Versöhnungstag (3Mo 16,11-17), trat der Hohepriester zum Ort der Gottesnähe, besprengte ihn mit dem Blut des Opfertieres und brachte so das ganze Volk Israel in Kontakt mit dem Heiligen Gott. Im Hebräerbrief ist Jesus der Hohepriester, der dieses Opfer kultisch vollzieht.
Was passierte auf Golgotha?
So etwas Ähnliches wie im alttestamentlichen Opferkult: Sünde und Trennung werden von Gott beseitigt. Die heilsame und schützende Gemeinschaft mit Gott und miteinander wird hergestellt, vollzogen und gefeiert.
b) Bilder aus dem Bereich des sozialen Lebens
An zahlreichen Stellen spricht das Neue Testament davon, dass Jesus für jemand gestorben ist: «Für uns» (1Thess 5,10; Röm 5,8), «für alle» (2Kor 5,14; Röm 8,32), für gottlose» (Röm 5,6), «für den Bruder (1Kor 8,11; Röm 14,15), «für mich» (Gal 2,20). Jesu Tod wird als seine Hingabe «für viele» (Mk 10,45; 14,24) verstanden. Im Johannesevangelium gibt Jesus sein Leben «für die Schafe» (Joh 10,11.15), für die Freunde (Joh 15;13), «für das Leben der Welt» (Joh 6,51).
Der bildspendende Bereich ist die soziale Erfahrung, dass ein Mensch etwas zugunsten oder auch anstelle eines anderen Menschen tut. Es geht hier folglich um unterschiedliche Formen stellvertretenden Handelns bis hin zur aufopfernden Lebenshingabe für andere.
An vereinzelten Stellen steht dabei der eben erwähnte alttestamentliche Opferkult im Hintergrund, in dessen Vollzug ja auch stellvertretend gehandelt wird.
Die Mehrzahl der Stellen deutet Jesu Tod jedoch als Lebenshingabe aus Liebe und in Freiheit. Hier dient die hellenistische Freundschaftsethik als Bildgeberin und Interpretationsfolie. Jemand handelt zum Wohl und Heil eines anderen Menschen und geht in dieser Hingabe bis zum Äussersten.
Was passierte auf Golgotha?
Eine Bewahrung, Rettung und Förderung des Lebens, die immer dann möglich wird, wenn ein Mensch zugunsten anderer handelt. Jemand erleidet und erduldet etwas anstelle einzelner oder der Gemeinschaft. Jemand wirft sich ins Geschehen, um drohendes Unheil abzuwenden oder die Stadt zu schützen. Diese Proexistenz, diese Hingabe ist vorbildlich. Sie ist unfassbar, wenn dabei das eigene Leben hingegeben wird.
c) Bilder aus dem Bereich des Straf- und Besitzrechtes
Gerechtmachung vor Gericht
Als sinnvoll erwies es sich auch, juristische Analogien heranzuziehen, durch die Jesu Tod als gerechtes und zurechtbringendes Handeln Gottes erschlossen werden konnte. Im Hintergrund steht das Bild eines strafrechtlichen Verfahrens. Dabei geschieht nun etwas Aussergewöhnliches:
Ein Unschuldiger nimmt den Platz der Person ein, deren Ungerechtigkeit, Schuld und Strafwürdigkeit festgestellt sind. Da geschieht ein wundersamer Tausch: «Den, der von keiner Sünde wusste, hat er [Gott] für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden» (2Kor 5,21; vgl. Röm 8,3-4).
Dieser Wechsel von Sünde und Gerechtigkeit ist ein wiederkehrendes Motiv im Neuen Testament: Fluch/Segen (Gal 3,13), unter dem Gesetz/frei vom Gesetz (Gal 4,4).
Was passierte auf Golgotha?
Gott spricht und vollzieht sein gerechtes Urteil über die Ungerechtigkeit der Menschen. Er tut das aber nicht im Sinne einer vergeltenden, ausgleichenden Gerechtigkeit. Vielmehr lässt er sich selbst vom ungerechten, sündhaften Handeln der Menschen betroffen sein. Dem entspricht historisch, dass Jesus als Unschuldiger zu Unrecht zum Tode verurteilt worden ist. Auf diese Weise wird der tödlich eskalierende Zusammenhang von Sünde und Strafe durchbrochen. Gott stellt die Gerechtigkeit der Menschen nicht fest, sondern er spricht sie zu und stiftet sie.
Erlösung auf dem Sklavenmarkt
In ähnlicher Weise machte die Urchristenheit Gebrauch von der Metapher des Freikaufs mittels eines Lösegeldes (1Kor 6,20; 7,23). So wie ein Sklave freigekauft wird, so kauft Jesus durch seinen Tod die Menschen frei. Er gibt sich als Lösegeld (Mk 10,45; 1Tim 2,5). Dabei bleibt völlig unbeantwortet, an wen dieses Geld bezahlt wird. Im Fokus steht die Befreiung, etwa vom Fluch des Gesetzes (Gal 3,13; 4,5) oder seinen Forderungen (Kol 2,14-15).
d) Bilder aus dem Bereich des landwirtschaftlichen Lebens
Schliesslich konnte die Urgemeinde auf Vorgänge und Praktiken aus dem Bereich der Landwirtschaft zurückgreifen. Jesu Tod wird verglichen mit dem Samenkorn, das vergehen muss, damit Neues wachsen und werden kann (Joh 12,24; 1Kor 15,35-49). Auch das bereits erwähnte Bild vom Lebenseinsatz des Hirten für die Schafe (Joh 10,11-18) gehört im weiteren Sinne in den Bereich der Landwirtschaft. Ebenso die Geschichte von den Pächtern eines Weinbergs, die den Sohn des Besitzers töten, um den Weinberg an sich zu reissen (Mk 12,1-12).
4. Konsequenzen für theologische Deutungsversuche
Die vorangehende Skizze der neutestamentlichen Deutungen des Todes Jesu ist gezwungenermassen viel zu grob und oberflächlich. In den Literaturhinweisen finden sich weiterführende Beiträge zur eigenen Vertiefung. Und doch können wir von den Menschen des Neuen Testaments einiges lernen und beachten, wenn wir uns heute am KreuzWortRätsel probieren.
a) Vielfalt bestaunen
Der Reiz einer vereindeutigten Kreuzestheologie
Der Charme einer stimmigen, konsistenten, zugänglichen und zeitgemässen Lehre vom Kreuzestod Jesu ist gerade dann spürbar, wenn man den Eindruck gewinnt:
Es liegt wohl auch an der Theologie, an der Kirche selbst, dass Karfreitag niemanden mehr interessiert oder kaum noch glaubhaft gedacht wird.
Und vielleicht tut uns ein gesunder Ehrgeiz ganz gut, es besser zu machen, damit der Glaube an den Gekreuzigten inner- und ausserhalb der Kirche plausibler und kommunizierbarer wird.
Die Armut einer vereindeutigten Kreuzestheologie
Und doch: Theologische Modelle – das wird im zweiten Basistext zu Karfreitag deutlich werden – neigen immer dazu, die biblische Vieldeutigkeit durch Eindeutigkeit zu entleeren.
Die Unterschiedlichkeit an neutestamentlichen Zugängen zum Tod Jesu darf nicht eingeebnet werden. Denn in ihr drücken sich Staunen, Faszination und wohl auch Erschrecken über Gottes Handeln aus.
Karfreitag trägt eine Bedeutungs- und Sinnfülle in sich, die in einem Deutungsansatz auch nicht annähernd ausgeschöpft werden kann.
Musterbeispiel: Der stellvertretende Sühnetod Jesu
An den Begriffen «Sühne» und «Stellvertretung» lässt sich kurz deutlich machen, wie problematische Vereindeutigung vor sich geht. Beide sind zunächst nicht biblische, abstrakte Deutungskategorien. «Sühne» ist ein juristischer Begriff und stammt aus dem germanischen Rechtswesen. «Stellvertretung» ist erst seit dem 18. Jahrhundert im Sprachgebrauch.
Wenn nun der Satz, dass Jesus für uns oder für unsere Sünden gestorben ist, oberflächlich als stellvertretender Sühnetod gefasst wird, kommt es schnell zu einseitigen Verknüpfungen. Etwa indem behauptet wird, Jesu Tod sei hauptsächlich auf dem Hintergrund des alttestamentlichen Opferkultes zu verstehen.
Stellvertretung ist nicht gleich Stellvertretung
Dann werden diejenigen Bibelstellen, in denen von Jesu stellvertretender Hingabe seines Blutes und Lebens gesprochen wird, unter einer einzigen Kategorie gesammelt. Was dabei verlorengeht: Es gibt – wie oben angedeutet – unterschiedliche Formen von Stellvertretung und Hingabe. Sie stammen in den meisten Fällen gar nicht aus dem Bereich des Opferkultes. Wie vielschichtig und komplex das Neue Testament an dieser Stelle vorgeht, skizziert Jörg Frey in seinem Aufsatz «Probleme der Deutung des Todes Jesu»
b) Zeitgemässe Deutung wagen
In seiner Ökumenischen Dogmatik hat Edmund Schlink seiner eigenen Zunft eine verheissungsvolle Perspektive mitgegeben:
«Dass die Heilsbedeutung von Jesu Tod unser Begreifen übersteigt, wird gerade durch das Nebeneinander mehrerer Auslegungen und die Verwendung mehrerer Begriffe und Schemata, die sich nicht völlig zur Deckung bringen lassen, ersichtlich. Das alles besagt, dass die Bezeugung der Heilsbedeutung des Kreuzes wegen der überwältigenden Einzigartigkeit dieses Ereignisses unabgeschlossen und für weitere Deutungen offen bleibt.» (Schlink 1995, 347)
Bescheiden
Das eine Wort vom Kreuz für alle Menschen und zu allen Zeiten gab es noch nie und wird es wohl auch nie geben. Das liegt einerseits an der geheimnisvollen Bedeutungs- und Sinnfülle dieses Ereignisses, die sich nicht durch einen Begriff, eine Deutungskategorie oder ein Modell einhegen lassen. Andererseits ändern sich die bildspendenden Bereiche kulturell und werden fremd. Metaphern, durch die sich Teilaspekte des Todes Jesu einst erschliessen liessen, werden unbrauchbar. Unbrauchbar gewordene erleben vielleicht eine unerwartete Renaissance.
Beherzt
Der Mut, eine beschränkte und zeitgemässe Deutung des Todes Jesu zu wagen kommt letztlich aus der Erfahrung, dass dieses Ereignis seit Jahrtausenden die interpretierenden Kräfte der Menschen zu neuen Deutungen befähigt.
Es ist nicht einfach so, dass wir den Sinn des Kreuzes von wer weiss woher erfinden müssen. Der Sinn des Kreuzes findet uns, und darin liegt seine Ermächtigungsmacht.
Kreativ
Das, was wir im Neuen Testament beobachten, lässt sich durch die Theologiegeschichte hindurch bis heute beobachten. Zum einen prägt das Ereignis des Todes Jesu die Sprache der Menschen, es drängt sich kreativ auf und bringt uns neue Worte bei.
Das, was bisher unter «Opfer» verstanden worden ist, wird in der Anwendung auf das Kreuz transformiert und überboten. Die Metapher wird gesprengt, nur schon, weil der Gekreuzigte nicht nur als aktiv sich hingebendes Opfermaterial, sondern als Hohepriester vorgestellt wird, der die Praxis des Opferns beendet.
Andererseits führen das kreative Erzählen und Experimentieren mit Bildern zu vertiefter Erkenntnis dessen, was nun wirklich da ist, um gedeutet zu werden. Das Bild des guten Hirten etwa, der sein Leben für die Schafe hingibt (Joh 10,11-15), ermöglicht es, hinter der brutalen Folter und Ermordung Jesu eine Liebe zu erkennen, in der Gott uns alles schenkt, was er geben kann – sich selbst.
Erfahrungsorientiert
Das wahre Abenteuer, auf dass wir uns einlassen, wenn wir den Tod Jesu theologisch zu interpretieren wagen, ist die Erfahrung. Was bringen die besten Deutungen und Sinnpotenziale, wenn sie im Leben der Menschen nicht zu bedeutungsvollen Erfahrungen werden und Lebenssinn stiften?
«Bleibt die Heilsdeutung des Todes reines Gedanken- und Sprachspiel, dann vermag auch alle Erzählkunst die Sinnpotentiale des Todes Jesu nicht zur Geldung zu bringen. Andererseits ermutigen gerade die sprachlichen Konstrukte der ntl. Deutungeng des Todes Jesu dazu, auch heute innovativ und kreativ vom Tod Jesu zu erzählen.» (Zimmermann 2012, 373).
Fortsetzung folgt …
Im zweiten Beitrag zu Karfreitag geht es um die leidenschaftliche Kreativität, mit der die Alte Kirche, das Mittelalter und die Reformation den Tod Jesu gedeutet und kontextualisiert haben. Welche Modelle sind in diesen kreuzestheologischen Werkstätten entstanden? Wie hilft uns die neuzeitliche Kritik an den klassischen Modellen, ähnlich kreativ, zeit- und kontextfähig über Karfreitag zu sprechen?
Vgl. aus unserem Ostern-Dossier auch:
Teil 1: Was ist Ostern passiert?