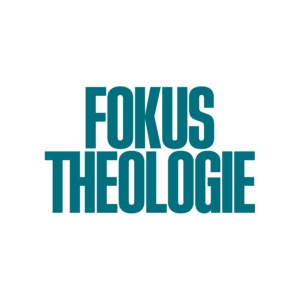Teil 2: Was ist der Sinn der Auferstehung heute?
1. Ist die Auferstehung Jesu ein reales Ereignis?
Dorothee Sölle erzählte einmal, wie ein Journalist ihr die Frage stellte, ob Jesus zu Ostern denn nun wirklich auferstanden sei oder nicht. Sie habe keine Lust gehabt, darauf direkt einzugehen und sich überhaupt gewundert, dass diese Frage so immer noch gestellt werde.
Jahrzehnte später muss man feststellen: Diese Frage wird immer noch so gestellt. Bis heute gibt es apologetische Versuche, die Realität der Auferstehung möglichst weitgehend zu begründen: so im Buch und Millionenbestseller «Der Fall Jesus (1998)» von Lee Strobel, der auch aufwändig verfilmt wurde (2017). Bis heute gibt es auch Bücher, die die Tatsächlichkeit der Auferweckung widerlegen wollen. So hat vor einigen Jahren der renommierte Mittelalter-Historiker Johannes Fried in «Kein Tod auf Golgatha (2019)» zu zeigen versucht, dass Jesus nicht wirklich gestorben sei und sein Überleben durch die Legende einer Auferweckung vertuscht worden sei.
Jesus Christus ist nach wie vor ein höchst öffentliches Thema. Vor allem extreme Deutungsansätze zu Ostern ziehen viel Aufmerksamkeit auf sich. In der historischen Forschung zu den Evangelien bleiben sie aber ein Randphänomen. Aber wie ist der Diskussionsstand in der wissenschaftlichen Exegese? Wird dort noch gefragt – ob Jesus wirklich auferstanden ist? Und wie wird diese Frage beantwortet?
2. Die Standardantwort: Auferstehung ist eine Glaubensfrage
Was ist Ostern passiert? Die Zeit ist vorbei, in der die Auferstehung entweder als mythologische Rede abgelehnt oder als Heilstatsache behauptet wurde, wie zu Zeiten der Bultmannschule und der Bekenntnisbewegung in den 1950/60er Jahren.
Tatsächlich gibt es einen ziemlichen Konsens quer durch das Spektrum der Exegese, z.B. zusammengefasst von Udo Schnelle:
«Historisch lassen sich die Erscheinungen und das ihnen vorausliegende Auferstehungsgeschehen nicht erweisen, zugleich aber auch nicht ausschliessen. Historisch können wir nur ermitteln, dass Anhänger des jüdischen Wanderpredigers Jesus von Nazareth nach dessen Kreuzigung und Tod behauptet haben, er sei ihnen als Lebendiger erschienen.» (Schnelle 2018, 102)
Wissenschaftliche Exegese betont heute die Grenzen der eigenen Arbeitsweise. Historische Arbeit beruht auf dem Grundsatz, dass man nur da von allgemeingültiger Erkenntnis reden kann, wo man auch von einer gemeinsamen Basis der Erkenntnismöglichkeiten ausgeht. Man kann historisch diskutieren über die Berichte vom leeren Grab oder den Erscheinungen des Auferstanden. Ob es eine Auferweckung selbst gegeben hat, das sei hingegen eine Frage, die nicht mehr mit wissenschaftlichen Mitteln beantwortet werden könne.
Man mag sich noch so berufen auf die Position der eigenen Kirche oder das Wahrheitsbewusstsein des modernen Menschen, am Ende gibt jede/jeder eine Einschätzung, die immer schon persönlich gefärbt und weltbildgeprägt ist. Oder wie Udo Schnelle es sagt:
«Bewertungen des Realitätsgehaltes des Auferstehungsgeschehens bewegen sich bei Befürwortern und Bestreitern gleichermassen auf der Ebene erkenntnistheoretischer Setzungen, lebensgeschichtlicher Erfahrungen und historischer Erwägungen.» (Schnelle 2018, 102.)
Die grosse Mehrheit dürfte eine solche grundsätzliche Sicht auf die Frage der Auferstehung teilen. Nur ist eine solche Haltung zur Auferstehung keineswegs selbstverständlich. Es handelt sich keineswegs um ein Verfahren, das man bei allen Themen anwendet, bei denen religiöse Ansprüche ins Spiel kommen.
Man würde z.B. nicht ganz genau so sagen: Die biblischen Texte erzählen eine Schöpfung der Welt vor ungefähr 6000 Jahren. Ob das realistisch ist oder nicht, ist eine Frage des Glaubens. So wird selbstverständlich nicht argumentiert. Denn für eine wissenschaftliche Exegese ist immer schon klar, dass der Wahrheitsanspruch von Forschung nicht davon zu trennen ist, wissenschaftlichen Konsens in anderen Bereichen zu akzeptieren. Die Welt ist offensichtlich nicht 6000 Jahre alt.
Aus ihrer eigenen Expertise ist den Bibelwissenschaftler:innen klar, dass die Erzählungen zur Weltschöpfung in keiner Weise den Charakter historischer Quellen haben. Es ist daher keine Frage des jeweiligen Glaubens, ob die Welt jung ist oder alt. Ganz ähnlich sähe es aus bei der Frage, ob alle Arten von Mensch und Tieren vor wenigen tausend Jahren vollständig bis auf ein bzw. sieben Paare ausgelöscht worden sind. Auch hier liegt keine Glaubensfrage vor, sondern eine Frage, an der sich intellektuelle Redlichkeit und bibelfundamentalistisches Weltbild scheiden.
Warum soll das bei der Frage der Auferstehung Jesu anders sein? Müsste man nicht auch hier sagen: entweder ein aufgeklärtes Weltbild – oder religiöser Fundamentalismus?
3. Die historischen Ränder der Auferstehung
Der Unterschied ist offensichtlich der, dass uns die Erzählungen von der Auferstehung Jesu in Quellen begegnen, denen in mancherlei Hinsicht ziemliche Glaubwürdigkeit unterstellt werden kann. Dass Jesus und seine Jüngerinnen und Jünger wirklich existiert haben ist wissenschaftlich unstrittig. Es gibt keine historischen Untersuchungen, die die Entstehung einer Erfindung Jesu plausibel machen. Die neutestamentlichen Auferstehungszeugnisse unterscheiden sich deutlich von frühchristlichen Schilderungen der Auferstehung, die wie eine Livereportage vom Ostermorgen anmuten. Das im 2. Jahrhundert verfasste Petrusevangelium beschreibt uns detailliert, wie der auferstandene Christus das Grab verlässt. Aber schon in der Alten Kirche wurde dieser Text zurückgewiesen als fromme Phantasie.
Auch in den kanonischen Evangelien gibt es Schilderungen, die weithin als fiktiv eingeschätzt werden. Gerade für das Johannesevangelium gibt es einen breiten Konsens, dass der Verfasser wohl grundsätzlich mit den Verhältnissen in Jerusalem gut vertraut war und sein Evangelium keineswegs als reine Dichtung einzuschätzen sei; aber dass es nun doch in vielen Erzählungen um eine narrative Veranschaulichung theologischer Einsichten geht. Grundsätzlich gibt es das auch in Einzelstoffen der Synoptiker. So heisst es im Matthäusevangelium zur Todesstunde Jesu: «Und die Gräber taten sich auf, und die Leiber vieler entschlafener Heiliger wurden auferweckt. Nach der Auferweckung Jesu kamen sie aus den Gräbern hervor und zogen in die heilige Stadt und erschienen vielen.» (Mt 27,52-54)
Ein so eindrückliches Wunder vor vielen Zeugen müsste ja eigentlich ein Schlüsselargument für christliche Apologeten sein. Aber auch diese machen nur spärlich von dieser Geschichte Gebrauch, weil wohl auch sie ahnen: Wenn eine solche Begebenheit nur in einem Evangelium überliefert wird und nirgendwo in zeitgenössischen römischen oder jüdischen Quellen belegt wird – ist ihre Beweiskraft zumindest fraglich. So geht denn auch der Exeget Thomas Söding davon aus, dass solche Begebenheiten nie einen historischen Anspruch hatten: «Hier ist klar, dass Matthäus ein Gleichnis erzählt. Er selbst war nicht naiv, seine Leserschaft war es auch nicht. Allen war klar, dass erzählerisch ein Bild gemalt wird.»
Plausibilität und Unableitbarkeit der ältesten Zeugnisse
Weitgehend aber sind die ältesten, später kanonisierten Texte höchst zurückhaltend. Vieles kann man für eine grundsätzliche Glaubwürdigkeit des Erzählten anführen.
- Erscheinungen. Paulus nennt im Ersten Korintherbrief die Zeugen der Erscheinungen Christi. Er erinnert daran, dass Jesus «begraben wurde, dass er am dritten Tage auferweckt worden ist gemäss den Schriften 5 und dass er Kefas erschien und dann den Zwölfen. 6 Danach erschien er mehr als fünfhundert Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch leben, einige aber entschlafen sind. 7 Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. 8 Zuallerletzt aber ist er auch mir erschienen.» Dieser Brief ist Anfang der 50er Jahre geschrieben, d.h. Paulus betont mit Recht, dass knapp 20 Jahre nach den Ereignissen viele Zeugen noch leben und allgemein bekannt sind. So weiss man z.B. genau, wer von diesen inzwischen verstorben ist.
- Leeres Grab. Das älteste Evangelium Markus endet mit dem leeren Grab. Eine Begegnung mit Jesus wird nicht erzählt, nur die ungeheure Überraschung und der Schrecken der ersten Zeuginnen. «Da gingen sie hinaus und flohen weg vom Grab, denn sie waren starr vor Angst und Entsetzen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich.» (Mk 16,8) Man hat vermutet, dass eine Erzählung vom leeren Grab unwahrscheinlich sei, weil Gekreuzigte doch bestimmt kein Einzelgrab bekommen hätten. Aber tatsächlich zeigen archäologische Funde, dass auch Gekreuzigte ihren Familien ausgehändigt wurden und begraben werden konnten.
- Sicht der Gegner. Insgesamt wissen wir wenig, wie die Gegner der Jesusbewegung gedacht haben. Aber das leere Grab war höchstwahrscheinlich auch bei ihnen unumstritten. Nur so macht die Erzählung in Mt 28 Sinn, dass Soldaten dafür Geld gegeben worden sei zu behaupten: «Seine Jünger seien in der Nacht gekommen und hätten ihn gestohlen.» (Mt 28,12-13).
- Frauen als Zeuginnen. An mehreren Stellen wird erwähnt, dass Frauen die ersten Zeuginnen sind: «Es waren dies Maria aus Magdala und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, und die anderen Frauen, die mit ihnen waren. Sie sagten es den Aposteln; denen aber erschienen diese Worte wie leeres Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht.» (Lk 24,10-11) Das ist insofern bemerkenswert, als das Zeugnis von Frauen zumindest für viele damals keine Beweiskraft hatten. So lässt Paulus in seiner Liste der Zeugen die Frauen aus. Warum sollten also alle vier Evangelien weibliche Zeuginnen an den Anfang stellen, wenn das in damaliger Zeit eher fragwürdig erscheinen konnte?
- Zweifel und Skepsis. Anders als in mythologischen Geschichten wird nicht einfach nur erzählt. Ausdrücklich werden Zweifel und Unsicherheiten erwähnt. Auch bei der abschliessenden Erscheinung in Mt 28 heisst es: «Und als sie ihn sahen, warfen sie sich nieder; einige aber zweifelten.» (Mt 28,17)
- Ungeschöntes Bild der ersten Führungspersonen. Die Flucht der Jünger nach der Kreuzigung war rückblickend sicherlich beschämend für die erste Generation. Das gilt erst recht von der Verleugnung durch Petrus. Vieles wird erzählt, worin die erste Generation einen ganz unheroischen Eindruck macht, auch das Zögern, den Auferstehungsberichten zu vertrauen. Die Texte haben keine Tendenz zur Selbststilisierung.
- Ringen um die Realitätsweise. Die Frage nach der Realität der Erscheinungen beschäftigt die erste Generation. War es ein Geist? Es gibt ein Wissen um Erscheinungen, die illusorischen Charakter haben. Darum die teils drastischen Schilderungen der Auferstehungswirklichkeit. Sie zeigen, welche Fragen damals umgingen: «Seht meine Hände und Füsse: Ich selbst bin es. Fasst mich an und seht! Ein Geist hat kein Fleisch und keine Knochen, wie ihr es an mir seht. 40 Und während er das sagte, zeigte er ihnen seine Hände und Füsse. 41 Da sie aber vor lauter Freude noch immer ungläubig waren und staunten, sagte er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? 42 Da gaben sie ihm ein Stück gebratenen Fisch; 43 und er nahm es und ass es vor ihren Augen.» (Lk 24,39-43)
Diese Beobachtungen führen dazu, dass die Auferstehungszeugnisse in der Exegese nicht einfach als Erfindungen abgetan werden. Die Exegese geht nicht davon aus, dass all diese Erzählungen wie historische Berichte stimmen. Aber bei den Erzählungen vom leeren Grab und den Erscheinungserfahrungen handelt es sich um verdichtete Zeugnisse, deren Grundzüge auch geschichtlich glaubwürdig sind.
4. Auferstehung Jesu – Spektrum der Deutungen
So sehr heute grundsätzlich Einvernehmen darüber besteht, was Exegese kann und was nicht, so sehr gibt es ein Spektrum von Einschätzungen zum Realitätsgehalt der Auferstehung.
a) Die Zuverlässigkeit der Auferstehungsberichte
Insbesondere der britische Exeget NT Wright hat ausführlich dafür plädiert, dass die Exegese sich nicht zurückziehen dürfe auf eine ergebnisoffene Aussenbeschreibung. Kirche und Theologie können sich nicht einfach der Anschauung der skeptischen Aufklärung unterwerfen, dass alles Übernatürliche von vorneherein in der Öffentlichkeit nicht ernst zu nehmen sei. In einem voluminösen Band zur Auferstehung (The Resurrection 2003) argumentiert er, dass die leibliche Auferstehung Jesu bis heute ein auch historisch gut begründeter Glaube sei.
Kurz gefasst argumentiert Wright so: Die vielfältigen Berichte vom leeren Grab und von den Erscheinungen sind historisch sehr glaubwürdig. Ausführlich zeichnet Wright nach, wie die Zeitgenossen der damaligen Ereignisse über Tod und Jenseits dachten. Man muss sich als Historiker fragen: Ist es vorstellbar, die Erscheinungen natürlich zu deuten – als Trauerbewältigung, als Mechanismus, an seinem Glauben festhalten zu wollen? Gründlich zeichnet Wright nach, dass alle solche Versuche fehlgeschlagen sind. Denn für die Generation der ersten Gläubigen war so etwas wie eine Auferstehung keineswegs erwartbar. tatsächlich passte sie überhaupt nicht in das Weltbild der jüdischen Zeug:innen.
Bei Lukas wird sehr realistisch wiedergeben, wie die Jünger Jesu vor seiner Auferstehung gesehen haben: «Jesus von Nazaret, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk (…) 21 Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde; doch jetzt ist es schon drei Tage her, seit dies geschehen ist.» Gerade von dieser Nachfolgefrömmigkeit her sprengten Erzählungen von seiner Auferstehung alle Erwartungen.
Auferweckung war im Judentum eine Hoffnung für das Ende der Welt. Dass ein einzelner von Gott auferweckt wird, ist nicht aus jüdischen Hoffnungen ableitbar. Faktisch war die frühchristliche Bewegung gezwungen, ihr ganzes Weltbild neu zu ordnen. Das erklärt, warum die ältesten Berichte mit so einem Schock wie in Markus 16,8 enden konnten. Eine solche dramatische Veränderung des Weltbildes kann nur durch einen starken Anstoss von aussen bewirkt worden sein. Alles in allem, so Wright, sei die These, dass Jesus wirklich erschienen ist, wahrscheinlicher als andere Hypothesen.
Am Ende fehlt auch bei Wright und anderen nicht die Einsicht: Ostern ist eine Glaubenserkenntnis. Die Wirklichkeit der Auferstehung ist nicht zwingend zu erweisen. Eindeutig stellt Wright fest:
“I do not claim that it constitutes a ‘proof’ of the resurrection in terms of some neutral standpoint.” (Wright 2003, 717)
b) Die Bedeutung der Leiblichkeit
Für eine zweite Gruppe in der Exegese ist die leibliche Dimension der Auferstehung wichtig. Sie lehnt aber alle Versuche ab, die Auferstehung apologetisch als historische Tatsache sichern zu wollen. So lehnt es Jörg Frey (Frey 2018) ab, Argumente für die Auferstehung als historische Tatsache zusammenzutragen. Nach den üblichen Kriterien der Geschichtswissenschaft ist ein solches Ereignis nichts, worauf man sich kritisch und intersubjektiv einigen könnte.
Aber die Exegese könne nicht nur bei einer solchen negativen Auskunft bleiben. Auch Frey betont: «Die Auferstehung eines einzelnen, auch einer messianischen Gestalt, ist in vorchristlichen Kreisen nicht belegt; sie war nicht Teil des religiösen Verstehensrepertoires der palästinensischen Zeitgenossen Jesu.» (Frey 2018, 330)
Schon von daher ist die Einsicht wesentlich:
«Die Kategorie der ‘historischen Tatsache’ bleibt eine fatale Unterbestimmung der Auferweckung Jesu von den Toten. Die biblischen Texte beanspruchen, dass darin viel mehr als ein bloss historisches Ereignis geschah.» (Frey 2018, 336)
Für alle ursprünglichen Zeugen muss man betonen, dass sie einen jüdischen Hintergrund hatten. Viele Studien haben inzwischen gezeigt, dass es vor diesem geistigen Hintergrund undenkbar gewesen wäre, sich eine unkörperliche Auferstehung vorzustellen. Kritisch warnt Frey davor, «das Ärgernis der Auferstehung Jesu von den Toten im Horizont eines je zeitgenössischen Wirklichkeitsverständnisses wegzuerklären» (Frey 2018, 326)
Bei aller Anerkennung heutiger weltanschaulicher Herausforderungen müsse man auch würdigen, dass es im Bekenntnis zur leiblichen Auferstehung darum geht, dass Gott das Geschick dieser Welt wenden will. Und diese Welt und unser Leben hier gibt es nicht ohne Leiblichkeit.
«Wenn man die leibliche Dimension dieses Geschehens aus weltanschaulichen Gründen negiert, bleibt fraglich, was dieses Geschehen dann noch mit dem konkreten menschlichen Leben und Leiden zu tun haben kann.» (Frey 2018, 333)
c) Glaubenszeugnisse, keine Tatsachenberichte
Auf der anderen Seite gibt es nach wie vor Exeget:innen, die weder die Realität eines leeren Grabes noch die Annahme einer leiblichen Auferstehung auch im weiteren Sinne für nötig halten (Vgl. Schreiber 2018).
Die von Wright angenommene enge Verknüpfung vom leeren Grab und Erscheinungen besteht ihrer Meinung nach gar nicht. Im ausführlichsten Text über viele Erscheinungen, 1Kor 15, spielt das leere Grab keine Rolle. Gerade hier, wo Paulus sich mit Skeptikern auseinandersetzt, wo er also jedes Argument hätte brauchen können, betont er allein die Realität der Erscheinungen, nicht zuletzt seine eigene Begegnung.
Nicht nur hier fände sich kein Wort vom leeren Grab, sondern auch nirgends sonst in seinen Briefen. Die älteste Beschreibung des leeren Grabes finden wir bei Markus. Das Evangelium endet mit der Auffindung des Grabes als leer. Es werden keine Erscheinungen berichtet. Die Verse Mk 16,9-20 sind nach einheitlicher Erkenntnis aller Exeget:innen von liberal bis Evangelikal eine spätere Hinzufügung.
Sodann wird darauf hingewiesen, dass die Vorstellungen zur Auferstehung in neutestamentlicher Zeit durchaus vielfältig waren. So heisst es z.B. über Johannes den Täufer «Zu jener Zeit hörte Herodes, der Tetrarch, was man über Jesus erzählte, 2 und sagte zu seinem Gefolge: Das ist Johannes der Täufer! Er ist von den Toten auferweckt worden, und darum wirken solche Kräfte in ihm.» (Mt 14,1-2) Offensichtlich konnten sich Zeitgenossen also eine Wiederkehr aus dem Tod ohne leeres Grab vorstellen.
Jesus selbst sagte von den Erzvätern, dass sie bei Gott Lebendige sind, obwohl man zugleich um ihre Gräber wusste (Mk 12,26-27). An die Lebendigkeit Jesu hätte man auch damals schon glauben können ohne leeres Grab und leibhaftige Erscheinungen.
Aber auch liberale Exegeten wie Theissen/Merz 2023 betonen: Das leere Grab sei zwar keineswegs sicher; aber es gebe aber auch gute Argumente für eine solche Annahme. Es sei nur nicht nötig, den christlichen Glauben mit bestimmten Vorstellungen leiblicher Auferstehung zu verwechseln.
d) Die Überlieferung der Frauen
Feministische Theologinnen haben in den letzten Jahren eine interessante Beobachtung geteilt: «Feministische Exegetinnen weisen zunächst einmal darauf hin, dass die Tradition des leeren Grabes in den Evangelien den Frauen zugeschrieben wird.» (Strahm/Selvatico 2009, 184)
In allen Evangelien sind es Frauen, denen Jesus zuerst erscheint. Es sind Frauen, die zum Grab gehen, es sind Frauen, die die Botschaft des leeren Grabes verkündigen – und nicht ernst genommen werden. Und es waren Männer, deren Erscheinungserzählungen dann für voll genommen wurden. Paulus erwähnt in seiner Liste der Zeugnisse nur Männer.
Wir finden es leider auch heute mühelos plausibel, dass den Berichten der Frauen damals nicht geglaubt wurde. Bemerkenswert ist immerhin, dass dies in den Evangelientexten der Männer freimütig eingeräumt wurde.
Man sollte in diesen Zusammenhang zumindest wahrnehmen, dass es seit der Zeit der Aufklärung wieder viele männliche Exegeten waren, die die Erzählung vom leeren Grab und die Berichte von den Erscheinungen so miteinander verglichen, dass die Berichte vom leeren Grab (der Frauen) eher relativiert wurden und auf jeden Fall als nicht so bedeutsam galten wie die Zeugnisse von den Erscheinungen (der Männer).
Für das Zeugnis der Frauen ist bemerkenswert, dass es ihnen stärker um Praxis und Handeln geht, von der Salbung des Leichnams bis zum Aufbruch nach Galiläa zur Begegnung mit Jesus, weniger um theologische oder apologetische Theorien (Schüssler-Fiorenza 1997, 185-196). Und diese Beobachtungen dürften für das Verständnis der Auferstehung auch heute anregend sein.
5. Die Bedeutung von Ostern in unterschiedlichen Weltbildern
Nach unserem Durchgang stehen wir vermeintlich wieder am Anfang. Das Bekenntnis zur Auferweckung Jesu ist eine Glaubenssache. Das gilt im Sinne eines aufgeklärten Christentums, für das Glaube und Vernunft nicht von vorneherein Gegensätze sind. Auch die kritische Vernunft der Moderne kann einen Raum zum Glauben nicht vollständig ausschliessen; schon gar nicht zu Ostern. Es wäre unvernünftig, die Ostererzählungen in eine Reihe zu stellen mit altorientalischen Flutlegenden, mittelalterlichen Heiligenviten oder modernen Verschwörungserzählungen.
Grundlegend ist die Einsicht, dass sich nachträglich «historische Tatsachen und Ereignisse nicht von ihren Interpretationen absondern lassen» (Schröter/Jakobi 2017 118). Es lässt sich aus den Erzählungen keine ungedeutete Realität ableiten, kein Rohmaterial an reinen Fakten.
So ging es auch damals nie nur um die Frage: Ist die Auferstehung passiert oder nicht? Alle versuchten, sie gleichzeitig zu verstehen, sie zu deuten innerhalb der eigenen weltanschaulichen Möglichkeiten. Und das führte auch im Neuen Testament schon zu unterschiedlichen Zugängen.
a) Anfang der neuen Welt
Offenbar war die Rede von der Auferweckung schon von Anfang an eine Deutung. Denn gerade das, was bekannt wird, dass Gott Jesus auferweckt habe – hat niemand gesehen. Auferwecken – ist ohnehin eine Metapher. Bekanntlich ging niemand davon aus, dass Jesus geschlafen hat. Dass Gott ihn auferweckt hat, das ist eine bildliche Redeweise, die nur Sinn ergab im Horizont der jüdischen Erwartung einer endzeitlichen Auferweckung der Toten. Das, was die ersten Zeuginnen bekannten, war mehr, als leeres Grab und Erscheinungen zeigen konnten: Der Anfang vom Ende aller Dinge, der Beginn der grossen Heilszeit Gottes.
In der Rede von der Auferstehung ging es darum: Die von Jesus angekündigte Gottesherrschaft ist angebrochen. Die Erneuerung aller Dinge hat begonnen. Diese Sicht drückt sich aus in Formulierungen, die die Auferstehung sehen als Einsetzung Jesu als «Sohn Gottes in Kraft» (Röm 1,3). Er repräsentiert Gottes neue Welt. Er ist der «Erstgeborene unter vielen Brüdern» (Röm 8,29) bzw. der «Erstgeborene von den Toten» (Offb 1,5), der «Erstling der Entschlafenen» (1Kor 15,20) und damit der «Anfang des Lebens» (Apg 3,15).
Für die ältesten Zeugnisse war klar, dass mit der Auferweckung Jesu das Ende der Welt angebrochen war und dass es nicht mehr lange dauern könne. Für sie war ein apokalyptisches Weltbild selbstverständlich. Heute fragen wir schnell: Ist ein solches Denken 2000 Jahre später nicht anachronistisch?
Was machen wir mit dieser Sicht? Können wir uns von einer solchen Demnächst- oder Nah-Erwartung lösen und annehmen, dass das der Zukunftshoffnung nicht schadet? Zugleich zeigen schon die neutestamentlichen Texte, dass diese Fremdheit gegenüber dem apokalyptischen Weltbild nicht modern ist. Schon in der griechisch-römischen Welt wurde ein solches Denken als zutiefst fremd erlebt.
b) Überwindung des Todes und Hoffnung auf Unsterblichkeit
Für die griechischen und römischen Hörer:innen war dieser apokalyptische Aspekt offensichtlich befremdend und unverständlich. Paulus erfährt in Korinth Widerspruch: «Wenn aber verkündigt wird, dass Christus von den Toten auferweckt worden ist, wie können dann einige unter euch sagen, es gebe keine Auferstehung der Toten?» (1Kor 15,12)
Nun sind die neutestamentlichen Zeugnisse durchweg bemüht, ihren Gläubigen aus den Nationen typisch apokalyptische Anschauungen nahe zu bringen. Es gibt aber Grenzen. Die jüdischen Gläubigen konnten Jesus mit dem vom Himmel kommenden Menschensohn identifizieren, einer himmlischen Erlöserfigur der apokalyptischen Literatur vom Buch Daniel bis zum Äthiopischen Henoch.
Obwohl der Menschensohn-Titel in den Evangelien eine grosse Rolle spielt, hat er schon für die nächste Generation keine Bedeutung mehr. Auch bibeltreue Gläubige heutiger Zeit beziehen sich faktisch überhaupt nicht mehr auf diesen Titel.
Offensichtlich ist seine Verknüpfung mit einer bestimmten apokalyptischen Denkweise so stark, dass sie sich ausserhalb dieser Welt nicht mehr sinnstiftend verwenden lässt.
Schon die Autoren des Neuen Testaments stehen vor der Herausforderung, ihren Glauben in andere Sprachmuster übersetzen zu müssen als diejenigen, in denen sie ihren Glauben am Anfang auszudrücken gelernt haben. Sie entwickeln Übertragungen ihres Glaubens und ihrer Hoffnung in Sprache und Denken ihrer Hörer:innen. In den Evangelien zeigt es sich, wo etwa Lukas Jesu Argumentation für die Auferstehung aufgreift: «Lukas übersetzt die vorgefundene Argumentation in das Denken der hellenistischen Welt» (Feldmeier/Spieckermann 2017, 529).
Wie? Indem die anstössig apokalyptischen Details zurückgenommen werden. Vielmehr wird die im griechischen Denken populäre Idee der Unsterblichkeit verwendet, begründet durch die Auferweckung Jesu: «welche aber gewürdigt werden, jene Welt zu erlangen und die Auferstehung von den Toten (… ) können hinfort nicht sterben; denn sie sind den Engeln gleich und Gottes Kinder, weil sie Kinder der Auferstehung sind.» (Lk 20,34f.)
Paulus verkündet den Korinthern seine Auferstehungshoffnung auch mit den Motiven, die ihm aus dem apokalyptischen Denken heraus vertraut sind. Zugleich kann er gerade gegenüber hellenistisch geprägten Konvertiten diese Motive stark zurücknehmen. Im 2. Korintherbrief spricht er nicht nur von dieser und der kommenden Welt, er greift die den Griechen viel geläufigere Unterscheidung zwischen der sichtbaren bzw. vergänglichen und der unsichtbaren bzw. ewigen Welt (2Kor 4,17f.) auf. Auch das anschliessende Bild des inneren Menschen geht auf Platon zurück und knüpft insofern an bekannte Motive seiner Leser:innen an.
In 2Kor 5,3 streift Paulus beinahe die Vorstellung einer unsterblichen Seele, wenn er zwischen der irdischen und der himmlischen Leiblichkeit eine Art Zwischenzustand der «Nacktheit» annimmt. So auch 2Kor 5,8, wenn es heisst: «wir (…) wünschen noch viel mehr, unseren Leib zu verlassen und beim Herrn zu Hause zu sein.» Faktisch denkt Paulus nicht an eine unsterbliche Seele – der göttliche Geist in uns verbürgt ihm die Kontinuität zwischen dieser und jener Welt. Aber Paulus sucht nach einer Sprache, die so weit wie möglich und verantwortbar die Vorstellungswelt griechischer Tradition zu Hilfe nimmt.
c) Und heute?
Ostern und die Auferstehung werden nicht nur immer wieder neu gedeutet, sie ist selbst von Anfang an Deutung einer Erfahrung. Die Frage nach der Realität ist nicht zu trennen von der Bedeutung der Auferstehung. Wir teilen heute weder das jüdisch-apokalyptische Denken noch die griechisch-römischen Vorstellungen von Unsterblichkeit der Seele. Wie verstehen wir Ostern?
Wer sich auf Ostern einlässt, merkt bald: Man kann sich auf diese Frage nicht einlassen, ohne sich selbst grundsätzlich Rechenschaft zu geben, wovon man ausgeht und was man für möglich hält. Jede halbwegs seriöse KI antwortet auf die Gretchenfrage, was denn wirklich passiert ist: «Eine objektive, rein historisch oder naturwissenschaftlich gesicherte Antwort auf die Frage, was Ostern mit Jesus passiert ist, gibt es nicht.»
Es ist nicht nur heute eine Frage von Weltbild, persönlicher Erfahrung und Evidenz. Es war es damals schon. Wie verstanden die ältesten Zeugnisse die Auferstehung? Bedeutete sie einfach: Er ist wieder da? Aber warum – war er dann nicht einfach wieder da? Warum diese merkwürdige Mischung aus Präsenz und Entzogenheit in allen Texten? Weil genau dies wohl notwendig ist. Auferstehung ist mehr als eine Tatsache, die einfach vor uns steht. Es ist eine Realität und ein Zeichen zugleich, eine Frage und ein Impuls, die nur da einleuchten können, wo wir selbst Stellung beziehen. Welchen Sinn hat Ostern für uns heute?
Teil 2: Welchen Sinn hat die Auferstehung heute?
Teil 3: Was ist an Karfreitag passiert?
Zu Feministisch-theologischen Deutungen der Osterüberlieferung siehe jetzt vor allem auch: Evelyne Baumberger: Die Frauen am Grab
Literatur:
Feldmeier, Reinhard, Hermann Spieckermann (22017): Der Gott der Lebendigen. Tübingen: Mohr Siebeck.
Frey, Jörg (2018): Biblisch-theologische Reflexionen zum Bekenntnis zur Auferstehung Jesu Christi, in: Herzer, Jan, Anne Käfer, Jörg Frey (2018): Die Rede von Jesus Christus als Glaubensaussage. Tübingen: Mohr Siebeck, 325-249.
Fried, Johannes (2019): Kein Tod auf Golgatha: Auf der Suche nach dem überlebenden Jesus. München: C.H. Beck.
Hempelmann, Heinzpeter (32003): Die Auferstehung Jesu Christi – eine historische Tatsache? Argumente für den Osterglauben. Wuppertal: R. Brockhaus Verlag.
Hengel, Martin (2001): Das Begräbnis Jesu bei Paulus und die leibliche Auferstehung aus dem Grabe, in ders.: Studien zur Christologie. Kleine Schriften IV, hg. von C.J. Thornton, Tübingen: Mohr Siebeck, 386-450.
Lüdemann, Gerd (1994): Die Auferstehung Jesu. Historie, Erfahrung, Theologie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Schnelle, Udo: Die ersten 100 Jahre des Christentums. 30-130 n. Chr. Göttingen: Vandenhoeck 32019.
Schreiber, Stefan (2018): Von der Verkündigung Jesu zum verkündigten Christus, in: Ruhstorfer, Karlheinz (2018): Christologie, Paderborn: Ferdinand Schöningh, 69-140.
Schröter, Jens und Christine Jacobi (2017): Jesus Handbuch. Tübingen: Mohr Siebeck.
Schuessler Fiorenza, Elisabeth (1997): Jesus – Miriams Kind, Sophias Prophet. Kritische Anfragen feministischer Christologie. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.
Strahm, Doris, Pietro Selvatico (2009): Jesus Christus. Christologie, Zürich: TVZ.
Theissen, Gerd und Anette Merz (2023): Wer war Jesus? Der erinnerte Jesus in historischer Sicht. Ein Lehrbuch. Göttingen: Vandenhoeck.
Wright, N.T. (2003): The Resurrection of the Son of God. Mineapolis: Fortress Press.
Zimmer, Siegfried (2018): Wie glaubwürdig ist die Botschaft von der Auferweckung Jesu?
Vgl. zur Auferstehung auch das Podcastgespräch mit dem Schweizer Neutestamentler Peter Wick: Ist er wahrhaftig auferstanden? Neue Perspektiven auf Ostern. Glückauf und Halleluja. Bernd Becker und Peter Wick.