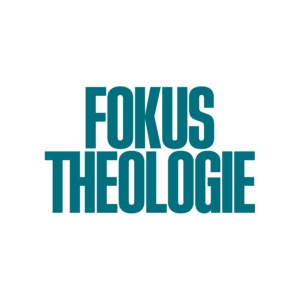Dieser Beitrag ist Teil unseres Jesus Dossiers. Am Beitragsende finden Sie weiterführende Informationen und Links.
Teil 1: Was ist Ostern passiert?
1. Einleitung
Wie können wir heute von der Auferstehung Jesu sprechen? Nicht nur historisch, sondern mit der Frage: Was bedeutet sie für uns? Welchen Sinn hat Ostern heute?
Es gibt keine allgemeingültige Antwort auf diese Frage. Auferstehung Jesu – das Thema leuchtet nur persönlich ein. Wer an die Auferstehung glaubt, hat selbst etwas davon erfahren. Wer von einer Bedeutung der Auferstehung redet, dem hat dieser Sinn irgendwann eingeleuchtet.
Zugleich gibt es auch keine private Antwort auf diese Frage. Den Sinn der Auferstehung kann niemand für sich allein entdecken. Schon in der Urchristenheit war schnell klar:
Die Ursprungserfahrungen der Erscheinungen des Auferweckten haben nur wenige gemacht, in einem kleinen Zeitfenster nach seinem Tod. Alle anderen glaubten auf diese Erzählungen hin.
Dieser Glaube beruhte auch auf persönlichen Erfahrungen – aber eben nicht auf solchen Erscheinungen, wie sie von einigen der ersten Generation erzählt worden waren. Wer an die Auferstehung glaubt, der glaubt anderen ihren Glauben. Der glaubt immer mit anderen zusammen. Privatchristentum gibt es so wenig wie Privatsprache oder Privatlogik.
Daher ist die Kenntnis wesentlicher und auch unterschiedlicher Deutungen der Auferstehung alles andere als überflüssig. Es gibt keinen anderen Weg zum Glauben.
2. Auferstehung als Schlüsselereignis
Der Theologe Ingolf Dalferth machte zuletzt auf ein wichtiges Problem aufmerksam. Die Auferstehung gehört seit 2000 Jahren zum Kernbestand des Christentums. Aber: Anders als in späteren Zeiten, war sie am Anfang das zentrale Ereignis schlechthin. Erst von Ostern, von den Erscheinungen Jesu her, entsteht die Frage nach dem Sinn des Kreuzes.
Erst von dieser Erkenntnis her, dass Gott Jesus nicht im Tod liess, sondern dass seine Auferweckung seine Rede von Gott bestätigte, wurde der Ursprung Jesu zu einem entscheidenden Thema. Nun erst dachte man über die Beziehung des Menschen Jesus zu Gott intensiv nach. Schon sehr bald sprachen die ersten Jünger davon, dass Jesus schon vor seiner irdischen Geburt existiert haben müsse (Phil 2,6-11), seinen Ursprung letztlich in Gott sei, ja er selbst irgendwie göttlich sei (Joh 1,1).
Aus dem Menschen Jesus wurde der Menschgewordene.
In den nächsten Jahrhunderten, ja bis in unsere Zeit, so Dalferth, wurde das die Hauptfrage der Christologie: Was bedeutet die Inkarnation, die Menschwerdung bzw. Fleischwerdung Christi? Cur Deus Homo – Warum wurde Gott Mensch? – so heisst ein 1099 von Anselm von Canterbury veröffentlichtes Buch. Dieses Werk bringt für die Christologie noch einmal eine wichtige Verschiebung mit sich. Von nun an wird der Tod Jesu am Kreuz zum entscheidenden Ziel der Menschwerdung. Gott wurde Mensch, um für unsere Sünden sterben zu können, zur Versöhnung mit Gott.
Nach bald zwei Jahrtausenden theologischem Nachdenken über den Sinn der Inkarnation und des Kreuzestodes muss man feststellen: Die Auferstehung wurde dabei meistens nur noch als ein Nebenthema bedacht. Wenn Jesus Gott von Gott, Licht von Licht ist – dann ist es eine selbstverständliche Sache, dass der Tod ihn nicht halten kann. Natürlich steht er dann von den Toten auf. Wenn die Versöhnung mit Gott durch das Kreuz das eigentliche Ziel der Menschwerdung war, dann ist die Auferstehung eine Art logische Folge.
Was am Anfang des christlichen Glaubens stand, was alles Nachdenken über das Wesen Christi und den Sinn seiner Sendung überhaupt ausgelöst hat, wurde immer weniger für sich bedacht und ernstgenommen, so Ingolf Dalferth. Diese Entwicklung wird der tatsächlichen Bedeutung von Ostern für die Entstehung des christlichen Glaubens in keiner Weise gerecht. Dalferth regt daher zu einem Paradigmenwechsel an – und das völlig zu Recht.
Wenn die Auferstehung nur noch eine Art logische Konsequenz der Einsicht ist, dass Jesus Gottes Sohn ist – dann haben wir Staunen, Schrecken und Begeisterung der ersten Generation verlernt.
3. Auferstehung aus Sicht liberaler Theologie
a) Auferstehung als Symbol individueller Religion
Was bedeutet die Auferstehung in der liberalen Theologie? (Zur Einführung siehe hier und hier) Seit der Aufklärungstheologie des 18. Jahrhunderts ist es für liberale Gläubige entscheidend, dass die Auferstehung nicht mehr als objektive Tatsache, als ein geschichtlich nachweisbares Handeln Gottes zu verstehen ist. Auferstehung ist vielmehr eine subjektive Erfahrung der Jünger, die für sie zugleich eine Gottesbegegnung ist.
Christian Danz stellt fest:
«Die Entwicklungsgeschichte der Christologie der Moderne führte zu deren zunehmender Innenverlagerung. Das Christusbild beschreibt keine äussere historische Wirklichkeit mehr, sondern ist selbst der Ausdruck der reflexiven Struktur des Glaubensaktes.» (Danz 2013, 193).
Welchen Sinn kann eine solche Erfahrung ohne geschichtlich-objektiven Inhalt haben? Für liberale Gläubige ist es eine grundsätzliche Frage, Religion nicht mehr als objektive Tatsachenwelt zu behaupten. Natürlich wissen sie, dass ihnen traditionell oder extremreligiös Gläubige mangelnde Glaubensstärke unterstellen, ihnen Anpassung an den Zeitgeist oder Flucht ins subjektive Gefühl vorwerfen. Liberale Gläubige kennen solche Vorhaltungen zur Genüge.
Die liberale Antwort auf alle Vorwürfe mangelnden Glaubens lautet: Es geht uns keineswegs um einen Rückzug ins Subjektive. Zweierlei ist uns deutlich geworden: 1. Das vermeintlich eindeutige Bekenntnis zur objektiven Wahrheit des Glaubens ist von aussen betrachtet ebenfalls eine höchst subjektive Entscheidung. 2. Wenn es wirklich darum geht, nicht in persönlichen Erfahrungen stecken zu bleiben, dann brauchen wir letztlich einen wissenschaftlich redlichen Umgang mit der Bibel. Eine Schriftauslegung, die nicht nur Menschen überzeugt, die bestimmte Glaubenspositionen immer schon mitbringen, sondern alle.
Dass eine solche Haltung keineswegs zur grundsätzlichen Abwertung traditioneller Glaubensformen führen muss, zeigt Notger Slencka. Warum gibt es eine so lange Geschichte der Christologie, möglichst objektiv die absolute Wahrheit des Glaubens in gegenständlichen Aussagen fixieren zu wollen? Das ist nur zu verständlich:
«Es ist dem Glauben wesentlich, sich selbst nicht als Ursprung dessen zu wissen, worauf er sich als auf den Grund seiner selbst bezieht und wovon er sich abhängig weiss.» (Slenczka 2014, 232)
Dabei kommt es geradezu zu einer «Selbstvergessenheit als Vergessenheit der eigenen Produktivität» (Slenczka 2014, 233) Das ist existenziell wie religiös verständlich.
Problematisch wird es, wo eine solche Haltung dauerhaft zu einer Verdrängung der menschlichen Erfahrungswirklichkeit führt. Wenn sich die moderne Theologie bewusst macht, wie sehr menschliche Produktivität allererste Vorstellungen über Gott und Jesus imaginiert hat, verfolgt sie nicht das «Ziel, den Selbstvollzug des Glaubens durch die Aufklärung über seine geheime Produktivität zu verstören.» (Ebd.) Echter Glaube wird nie am Streben nach intellektueller Redlichkeit scheitern.
Im Bekenntnis zu Christus geht es nicht um die Anerkennung objektiver Sachverhalte. Vielmehr handelt es sich um eine symbolische Sprache, in der eine zentrale Einsicht vermittelt werden kann: Wert und Würde des Menschen verdanken sich keiner Form der moralischen oder existenziellen Leistung. Sinn und Wert unseres Lebens erfahren wir immer schon als Geschenk. Kreuz und Auferstehung führen uns vor Augen, wie bedroht, wie strittig menschliche Identität ist. Glaube an die Auferstehung bedeutet: Ich kann in diesem kontrafaktischen Urteil – Leben trotz Tod – Halt finden, weil ich darin auch mich und mein Leben als angenommen und gerechtfertigt erfahren kann.
b) Geborgenheit in der Liebe Gottes
Die jüngste liberale Dogmatik stammt von Ulrich Barth. Mit dem Theologen Traugott Koch betont Barth:
«Eine leibhafte Auferstehung oder leibhafte Erscheinung des Auferstandenen ist für uns eine nicht nachvollziehbare und nichts erhellende oder aufschliessende Vorstellung.» (Barth 2021, 531)
Was bleibt von Ostern? Freimütig räumt Barth ein, dass Ostern für ein liberales Christentum eine Herausforderung ist. Die Überschrift seines Kapitels lautet: «Das heikle Thema ‘Ostern’» (507). Aber Ulrich Barth ist auch kein Vertreter einer posttheistischen Theologie, für die Gott keine Realität mehr ausserhalb des menschlichen Bewusstseins hat.
Für ihn ist klar, dass jede Rede von Gott und Transzendenz in der Tätigkeit menschlicher Subjektivität wurzelt. Eine Offenbarungstheologie (wie die von Karl Barth, mit dem er in keiner Weise verwandt ist), die alles Mögliche über Gott meinungsstark behauptet und auf göttliche Selbstmitteilung zurückführt, ist für ihn nicht überzeugend. Das muss nicht zu einer Verabschiedung des Theismus münden.
Für Barth ist es zwar ausgeschlossen, Gottes Dasein zu begründen oder seine Wirklichkeit zu vermessen. Gleichwohl ist sie letzte Voraussetzung.
Mit einer wie ich finde hübschen Wendung redet er von einem «Theismus ohne Tremolo». (Barth 2021, 70)
Der Gedanke «eines letzten Grundes oder transzendenten Ursprungs aller Dinge» (Barth 2021, 124) ist keineswegs irrational.
Christliche Dogmatik sollte nicht mehr von Offenbarungstatsachen reden. Aber sie steht in einer langen Geschichte symbolischen Denkens, wie von Gott angesichts der Person Jesu, ihrer Verkündigung und des sich an ihn anschliessenden Glaubens zu denken sei. Das Besondere an Jesus war seine einzigartige Gottesgewissheit: Die Geborgenheit in der Liebe Gottes als Grund all seiner Worte und Taten.
Ostern kann für uns heute dies bedeuten: In den Erscheinungserfahrungen wurde den Gläubigen gewiss, dass diese Geborgenheit in Gott auch durch den Tod nicht zerstört wurde. Jesus lebt in Gott. Das ist der Sinn, den sie ihren Erfahrungen abgewannen. Glaube an die Auferstehung ist eine Vollendungsgewissheit und ein Ewigkeitsglaube, der bis heute einleuchten kann, wo man sich auf die Botschaft Jesu einlässt.
Dabei könne es heute nicht mehr um bildhafte Vorstellung persönlicher Fortexistenz in Analogie zum Leben in dieser Welt gehen. Im Blick auf alles Konkrete stellt Barth mit einem Ausdruck von Emanuel Hirsch fest:
«Unser irdisches Dasein vollzieht sich diesseits der Todesgrenze; alles, was wir darüber hinaus mutmassen, fällt in die «Nacht der Bildlosigkeit» (Barth 2021, 545) .
Man kann auch nicht einfordern, dass man an bestimmte Vorstellungen glauben müsse. «Das Fürwahrhalten des Glaubens lebt bereits von der grundsätzlichen Vorstellbarkeit seiner Inhalte. Wenn wir vom Jenseits der Todesgrenze jedoch keinerlei Vorstellungen haben, dann ist auch der Glaube mit seinem Latein am Ende.» (Barth 2021, 545)
Für Barth ist es eine Stärke des christlichen Glaubens, alle konkreten Vorstellungen loslassen zu können. Wir glauben an eine Geborgenheit in der Liebe Gottes in Ewigkeit. Unsere Vollendungshoffnung vertraut auf Gott, allein auch jenseits aller phantastischen Vorstellungen.
4. Realistische Christologie
In Texten Liberaler Theolog:innen entsteht manchmal der Eindruck, als gäbe es zu ihnen nur altgläubige oder evangelikale bzw. fundamentalistische Glaubensformen als Alternative. Aber so verhält es sich keineswegs.
Tatsächlich gibt es ein breites Spektrum von theologischen Ansätzen, die weder liberal noch evangelikal denken.
Nach dem Ersten Weltkrieg entstand mit der Dialektischen Theologie bzw. mit der Wort-Gottes-Theologie ein breiter Aufbruch von Ansätzen, die nicht zurück wollen zur vormodernen Theologie, sondern, man könnte sagen: postliberal eingestellt sind. Dazu gehören Theologen von Karl Barth und Emil Brunner über Dietrich Bonhoeffer bis zu Jürgen Moltmann und Eberhard Jüngel. Ich rede bei diesen unterschiedlichen Entwürfen von «realistischer Christologie», weil es ihnen allen darum geht, dass der Glaube sich auf ein reales Handeln Gottes in Christus bezieht, auch wenn wir diese Realität nur vermittelt durch Erzählungen und Bilder kennen.
a) Auferstehung als Unterpfand der Hoffnung (Karl Barth)
Diese Ansätze bestreiten keineswegs die moderne Einsicht, dass es keine Möglichkeit einer objektivistischen Sicherung vermeintlicher Heilswahrheiten gibt. Aber sie wollen ernst nehmen, dass unsere Gotteserfahrungen – Erfahrungen mit Gott sind, d.h.: Im Glauben an diesen Gott gehen wir immer schon von Gott aus. Die leibhafte Realität der Auferstehung ist wichtiger Ausdruck für einen solchen Vorrang Gottes. Hier wird exemplarisch sichtbar, was auch sonst gilt: Gott hat gehandelt und die Welt verändert. Was an Christus sichtbar wird, ist die umfassende Realität, an die wir glauben.
Karl Barth (siehe hier und hier eine Einführung) hat in seinen theologischen Anfängen Auferstehung als Chiffre verstanden, dass Gott der ganz Andere ist, der nie in den Zusammenhängen unserer Welt ein- und aufgeht. Auferstehung und Gott selbst wurden mehr oder weniger deckungsgleich. Mit der Zeit hat Barth der Auferstehung immer mehr einen Eigensinn abgewonnen.
Im Kreuz Jesu offenbart sich Gott als der, der ganz auf unserer Seite steht. Die Auferweckung unterstreicht nur die Realität der Offenbarung Gottes in Jesus Christus. «Man muss es hören und sich erzählen lassen, dass es da ein leeres Grab gegeben hat, dass neues Leben jenseits des Todes sichtbar geworden ist.» (Barth 1987, 144)
Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg beschreibt Barth die Auferstehung als Unterpfand, dass Gott für den Menschen einsteht, auch wenn es nicht immer so aussieht:
«Ostern ist gewiss erst das grosse Unterpfand unserer Hoffnung, aber zugleich ist diese Zukunft in der Osterbotschaft schon Gegenwart. Sie ist die Anzeige eines schon gewonnenen Sieges. Der Krieg ist zu Ende – auch wenn da und dort Truppenteile noch schiessen, weil sie von der Kapitulation nichts gehört haben. » (…)
«Die Osterbotschaft sagt uns, dass unsere Feinde: Sünde, Fluch und Tod geschlagen sind. Sie können letztlich nicht mehr Unheil stiften.» (Ebd.)
«Mag es da hinten brennen – und wahrhaftig, es brennt – aber nicht auf das haben wir zu schauen, sondern auf das andere, dass wir eingeladen sind und aufgerufen, den Sieg der Herrlichkeit Gottes in diesem Menschen Jesus ernst zu nehmen und uns seiner zu freuen.» (Barth 1987, 143)
Man mag die Sprache martialisch finden und darin vielleicht auch fragwürdig. Man sollte sich vor Augen halten: So redet der Schweizer Karl Barth 1946 «in den Halbruinen des einst so stattlichen Kurfürstenschlosses in Bonn» (Barth 1987, 5), für eine Generation von Theologiestudierenden voller Front- und Kriegserfahrungen.
Wenn der Schweizer Theologe den Deutschen vom Sieg über die Feinde Gottes und der Menschen redet, bedeutet das für diese Generation auch: Wir sind keine Feinde mehr und wollen es nie wieder werden. Weil Christus unser Frieden ist, können wir neu anfangen. Für viele Menschen war diese christliche Botschaft nach dem Zweiten Weltkrieg eine ungeheure Hilfe zum Neubeginn, trotz aller historischer Schuld.
b) Hoffnung auf Ganzheit (Wolfhart Pannenberg)
Wolfhart Pannenberg teilt den Anspruch einer solchen realistischen Christologie. Zugleich sah er die Theologie Karl Barths und seiner Anhänger:innen in der Gefahr, die Wahrheit des Glaubens zu behaupten in einer Weise, die das kritische Bewusstsein der Aufklärung mehr überspringt als wirklich durcharbeitet.
Pannenberg war überzeugt: Wenn es Ostern um eine Realität geht, dann müssen wir das nicht nur als eine religiöse Entscheidung für ihre Wahrheit kommunizieren, dann müssen wir es vernünftig erweisen (nicht beweisen) können.
Pannenberg ist der einer der wenigen Systematiker, der immer wieder exegetische Einsichten zum Ausgangspunkt seiner Systematik gemacht hat. Für den urchristlichen Glauben an die Auferstehung Jesu war die Erwartung der Auferweckung der Toten am Ende der Zeit die Voraussetzung. Nur im Horizont einer solchen Erwartung konnten die Erscheinungen Christi gedeutet werden als Beginn der messianischen Heilszeit. Dann aber gilt nach Pannenberg:
«Nur wenn die allgemeine Erwartung einer künftigen Auferstehung aller Menschen oder jedenfalls der Gerechten vom Tode in sich sinnvoll und im Zusammenhang eines heutigen Verständnisses der Wirklichkeit des Menschen denkbar ist, kann die Möglichkeit eines derartigen Geschehens, wie es die christliche Osterbotschaft berichtet, ernsthaft erwogen werden.» (Pannenberg 1990, 112)
Aber kann man das ernsthaft sagen? Hat nicht die moderne Theologie betont, dass das mythologische Weltbild der Antike heute unannehmbar ist? Pannenberg hält eine solche pauschale Ablehnung des vermeintlich antiken Wunderglaubens nicht für schlüssig. Die biblischen Texte selbst haben ein klares Bewusstsein dafür, dass sie bildlich und indirekt vom Handeln Gottes reden, als etwas, was all unser Denken übersteigt.
Für Pannenberg ist eine umfassende Skepsis nicht rational zwingend. Die christliche Erwartung einer leiblichen Auferweckung passt sehr viel besser zur heutigen Anerkennung der leiblich-seelischen Ganzheit des Menschen, als Spekulationen zu einer rein seelischen Fortexistenz. «Unserem heutigen Wissen vom Menschen ist der Gedanke einer Auferweckung der Toten gerade in diesem Punkt gemässer, weil er in seiner Bildhaftigkeit seiner Sprache die Einheit von Leiblichem und Seelischen festhält.» (Pannenberg 1990, 114)
Kann eine solche Erwartung eines umfassenden Endes der Welt- und Menschheitsgeschichte heute noch einleuchten? Pannenberg ist davon überzeugt.
«Ohne die Frage nach einer Erfüllung über den Tod hinaus würde auch das Leben diesseits des Todes sinnlos. Dagegen, im Lichte einer Hoffnung über den Tod hinaus, stellt sich unser irdisches Leben als Fragment eines grösseren, noch im Geheimnis verschleierten Ganzen da.» (Pannenberg 1990, 113)
Das ist für Pannenberg die Alternative: Ist mit dem individuellen Tod alles aus, so bleibt unser aller Leben ohne Sinn im Ganzen. Es bleibt eine Folge schöner und schwieriger Momente, die im Nichts hängen, die sich nicht zu einer sinnvollen, kohärenten Ganzheit verbinden.
Ein solcher Gedankengang beweist natürlich nichts. Aber er verweist auf die Idee eines höheren Sinns des Ganzen. Ein solcher Monotheismus ist alles andere als irrational. Nicht nur in der Bibel, auch in der griechischen Philosophie ist ein solcher Gottesgedanke als Abschlussidee des Ganzen entwickelt worden. als
Wo ein solcher Horizont einleuchtet, da kann die Idee einleuchten, dass sich ein solcher umfassender Sinn auch schon vorweg in der Geschichte zeigt. Nun war Pannenberg klar, dass dies nicht mit den Mitteln einer antimodernen Apologetik funktionieren kann, die die Möglichkeiten historischer Forschung immer schon überschätzt. Es gibt keine Beweise für die Auferstehung als historische Realität.
Die Auferstehung Jesu ist eine Vorwegnahme des Endes aller Dinge. Hier zeigt sich das Ziel der Universalgeschichte. Der Weg des christlichen Glaubens durch die Zeit ist keine Frage irrationaler Zustimmung. Dieser Glaube bewährt sich auf lange Sicht.
Mit diesem Versuch einer neuen Verbindung von Glaube und Vernunft hat Pannenberg stark auch auf evangelikale Apologeten gewirkt. Einer der bekanntesten, William Lane Craig, hat bei Pannenberg promoviert und versucht seit Jahrzehnten, die Wahrheit des Christentums vernünftig zu verteidigen. Anders als Pannenberg waren er und andere Denker jedoch nie bereit, sich umfassend auf den wissenschaftlichen Horizont des heutigen Denkens einzulassen.
5. Befreiungstheologische Auferstehung
Seit vielen Jahren ist die Alternative: Liberal oder konservativ? – eigentlich antiquiert. Befreiungstheologien unterschiedlicher Prägung werfen Liberalen wie Konservativen gleichermassen vor, sich allen Unterschieden zum Trotz in wichtigen Fragen ähnlich zu sein, vor allem in der Ignoranz gegenüber allen sozialen bzw. politischen Fragen unserer Zeit.
a) Auferstehung als Aufstand gegen den Tod: Politische Theologie (Jürgen Moltmann)
Jürgen Moltmann (Vgl. hier eine Einführung) gehört zu den Theologen, die ihre massgebliche Prägung in der Wort-Gottes-Theologie in der Mitte des 20. Jahrhunderts erhalten haben. In den 1960er Jahren gehörte er zu den ersten, die über die Gegensätze von liberal oder konservativ hinaus neue Wege einschlagen. Seine Theologie der Hoffnung wird in zunehmender Verbindung mit unterschiedlichen Befreiungstheologien zu einem neuen Ansatz. Welche Theologie man vertritt, zeigt sich nicht zuerst an dem, was man glaubt oder nicht glaubt, sondern an dem, worauf man hofft. Wer an Christus glaubt, hofft auf den kommenden Gott, der glaubt an den Gott der Hoffnung und der Zukunft. Wer aber auf Gott hofft, verlernt die Gleichgültigkeit gegenüber unserem Leben in dieser Welt.
Moltmanns Theologie der Hoffnung setzt eine realistische Christologie wie selbstverständlich voraus.
«Die Auferstehungsbotschaft der nach Jerusalem zurückkehrenden Jünger hätte sich in der Stadt kaum eine halbe Stunde halten können, wenn man den Leichnam Jesu im Grab hätte nachweisen können.» (Moltmann 1989, 244)
Die Christologie hat zu vielfachen Engführungen geführt. Das Heil in Christus wurde zum Heil der unsterblichen Seele – und nicht des Leibes, ein Heil im Jenseits unter Preisgabe der Welt, ein Heil nicht für alle, sondern für wenige. Dass Gott in Christus die Welt mit sich versöhnt hat – davon war in vielen Entfaltungen der Osterbotschaft geschichtlich nichts zu spüren.
Wenn Auferstehung eine Befreiungsgeschichte ist, dann muss unser Glaube hineinnehmen in eine Bewegung, in der es um die Vereinigung des Getrennten geht. Auferstehungsglaube erlaubt keine Leibfeindlichkeit. Jede Abwertung der Frauen gegenüber den Männern spaltet die Menschheit. Abzulehnen sei aber auch jede «Abwertung des Fötus, des Embryos und der befruchteten Eizelle». (Moltmann 1989, 291)
Die Auferstehung versöhnt, im Gegensatz zu den Spaltungen unserer Welt. Die Einzelnen brauchen die Gemeinschaft, die die Einzelnen braucht. Alte und Junge sollten sich nie gegeneinander ausspielen lassen. Und heute müssen wir einen Schritt weitergehen.
Wenn die Erlösung durch Christus im Kolosserbrief auf das ganze All bezogen wird, dann sollten wir das nicht mehr als Übertreibung abtun, sondern als Zielbeschreibung: Es geht um Heil für den ganzen Kosmos. Darum sollten wir vom kosmischen Christus reden.
«Erst die Friedensvision von der Versöhnung des Alls öffnet den Erwartungshorizont, in welchem die durch menschliche Gewalttat verwundete Natur durch menschliche Friedensgeschichte geheilt werden kann.» (Moltmann 1989, 278f.)
Wenn wir an die Auferstehung Jesu glauben, dann geht es nie um uns allein. Dann geht es um Befreiung und Versöhnung. Dann geht es um einen neuen Horizont für die ganze Welt. In unserer Zeit, so Moltmann, können wir die grosse ökologische Krise der Menschheit nicht mehr ignorieren.
«Ist Jesus nicht nur zur Versöhnung von Menschen, sondern auch zur Versöhnung aller anderen Geschöpfe gestorben, dann hat jedes Geschöpf unendlichen Wert vor Gott und eigenes Recht zum Leben, nicht nur die Menschen.» (Ebd.)
b) Feministische Theologie (Dorothee Sölle)
1979 hielt Dorothee Sölle eine Vorlesung über die Grundlinien ihrer Theologie in Argentinien, mitten in der Zeit der Militärdiktatur. Seit ihrer Zeit in den USA war ihr die Solidarität mit südamerikanischen Befreiungstheologien und dem solidarischen Widerstand vieler Gemeinden gegen Ausbeutung und Unterdrückung wesentlich. Theologie könne immer nur engagierte Praxis sein, jeweils in ganz konkreten Herausforderungen.
Wenn Glaube eine Haltung der Weltflucht werde, sei er nicht nur unglaubwürdig, sondern schädlich. Glaube müsse verbunden sein mit dem Kampf für das Leben, für die Freiheit und Gerechtigkeit. Alle theologischen Gedanken müssen sich daran messen lassen, ob sie in diesem Kampf für das Leben stärken oder nicht. Denn:
«Wir brauchen mehr Hoffnung, als wir aktuell haben, und weiss Gott mehr Liebe als die, die wir gegenwärtig nehmen und geben.» (Sölle 1980, 85)
Der Glaube an Christus war in den biblischen Texten wie auch in Mittelalter und Reformation konkret: Umkehr von Sünde und Glaube an ein neues Leben. Diese Konkretion müssen wir wiederfinden. Wie können wir denn umkehren? Nur durch die Erfahrung von Gnade. Die Auferstehung Jesu war für die ersten Gläubigen ein solches Ereignis.
In der kirchlichen und vor allem in der bürgerlichen Religion beklagt Sölle die «vergessene Auferstehung» (Sölle 1980, 116). Die Kirche habe die Auferstehung vergessen, wenn sie Trost spendet, der nichts verändern darf.
«Welche Aussagen können wir machen, wenn wir das Gefängnis der bürgerlichen Theologie verlassen wollen? Welche Sprache können wir finden, um auch das Herzstück der bürgerlichen Theologie, eben ihren Individualismus, zu überwinden?» (Sölle 1980, 116).
Die Ostererzählungen waren einst «eine Botschaft von lebensverändernder Kraft». (Sölle 1980, 119) Die Kraft der Auferstehung muss im eigenen Leben real gespürt werden. Alles andere ist Selbstbetrug. Sie erinnert an die Kritik feministischer Theologinnen an der klassischen Theologie, die Christusverehrung stiften will ohne reale Umkehr und neue Beziehungen. Kein Wunder, dass eine solche Theologie viele kalt lasse.
Noch schlimmer sei eine Christusverkündigung, die ausdrücklich die autoritäre Politik der Unterdrückung rechtfertigt und Widerstand kriminalisiert. Mit Blick auf die gerade entstehende Christliche Rechte, Vorläuferin des heutigen Christlichen Nationalismus, sagt sie:
«Der autoritäre Charakter dieser Frömmigkeit berechtigt dazu, hier von einer Art Christofaschismus zu sprechen.» (Sölle 1980, 121)
Entscheidend für uns sei ein Glaube an Christus, der uns verwandelt. «Zu sagen, dass er auferstanden ist, hat nur Sinn, wenn wir wissen, dass wir auch auferstehen werden vom Tode, in dem wir jetzt sind.» (Sölle 1980, 120) Wir dürfen die Auferweckung nicht zu etwas Weltlosem machen, was nur mit dem individuellen Seelenheil derer zu tun habe, die diese Botschaft annehmen, ansonsten aber zur Gleichgültigkeit gegenüber den Menschen um uns herum anhält.
Auferstehung ist Befreiung vom Tod. Auferstehung stiftet neue Beziehungen. Auferstehung ist der Beginn des Reiches Gottes. An die Auferstehung glauben bedeutet daher: Solidarisch werden gegen alle Mächte des Todes und der Unterdrückung.
An die Auferstehung glauben, bedeutet auch: Gott neu entdecken. Gerade die Feministische Theologie bedeutete für Sölle eine Horizonterweiterung. «Gott wurde konkreter für mich.» (Sölle 1980, 132) Feministische Theologie half ihr, ihre abstrakte Form der Gott-ist-tot-Theologie der 1960er Jahre zu überwinden. Gott kann und muss neu gedacht werden. Gerade auch vom Zeugnis der Auferstehung her.
Wo Gottes Macht nur die Herrschaft der Diktatoren dieser Welt legitimiert, ist sie Teil des Problems und kein Grund zur Hoffnung. Die Auferweckung des Gekreuzigten zeigt uns einen anderen Gott.
«Wenn Gott seine Macht nicht aufgeben kann, können wir ihm nicht trauen. (…) Es gibt nur eine Legitimierung von Macht, und das ist, sie mit anderen zu teilen. Macht, die nicht geteilt ist, die in anderen Worten nicht in Liebe verwandelt wird, ist reine Herrschaft und Unterdrückung.» (Sölle 1980, 134)
c) Black Theology (Kelly Brown Douglas)
In ihrem Buch «Resurrection Hope: A Future Where Black Lives Matter» untersucht die bekannte Womanist Theologian (Schwarze Feministische Theologin) Kelly Brown Douglas die Bedeutung der Auferstehung Jesu im Kontext der anhaltenden Ungerechtigkeiten und Gewalt gegenüber Schwarzen in den USA.
Ganz persönlich beginnt sie ihr Buch mit einem Gespräch mit ihrem Sohn. Wie können wir noch Christen sein, habe er sie gefragt. Die weissen Patrioten und Nationalisten, die dieses Land so lange bestimmt haben und es mit Rassismus durchzogen haben, bekennen sich weit überwiegend als gläubige Christen. Sie feiern die Auferstehung. Was soll mir ein solcher Glaube, der unseren Leiden unberührt gegenübersteht?
Keine Frage treibe sie um wie diese, räumt Douglas ein. Mehrfach hat sie sich gefragt, ob sie sich nicht vom Christentum trennen muss, trotz ihrer langen theologischen Karriere, wenn dieser Glaube für die Mehrheit gerade seiner glühendsten Bekenner kein Impuls zur Gerechtigkeit und zur Ablehnung des Rassismus ist.
Das ist die entscheidende Frage. Ihre persönliche Antwort: Immer, wenn ich so radikal gefragt habe, habe ich erlebt: Dieser Jesus und diese Botschaft lassen mich nicht los. Es geht nicht um eine abstrakte Botschaft eines historischen Ereignisses. Es ist etwas passiert, das damals eine transformative Kraft hatte, die sich bis heute erweist.
Als junge Studentin hat sie bei James Cone (Vgl. zur Black Theology hier) gelernt: Wenn diese Geschichte wahr ist, wenn sie auch für uns Schwarze gültig ist, dann müssen wir sie als Botschaft vom schwarzen Christus weiter erzählen. Wenn Christus nicht auch unser Geschick auf sich genommen hat, dann bleibt er ein Jesus der Weissen.
Auferstehung eröffnete die Vorstellung einer neuen Realität. Diese Welt, in der die Mächtigen die Ohnmächtigen töten und erledigen, wird relativiert. Konkrete Vorstellungen einer Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung entstehen.
In der Gestalt eines Gekreuzigten zeige sich die Liebe Gottes: Diese Erfahrung steht im Zentrum der christlichen Erfahrung. (Douglas 2021, 120ff.) Diese Liebe ist eine «dynamic transcendent force» (Douglas 2021, 120). Sie wird sichtbar inmitten des tiefsten Leidens – als eine Kraft der Veränderung dieser Situation. Wir müssen diese Spannung aushalten.
Die Liebe rechtfertigt nicht das Leiden. Sie ist voller Widerstand und Aufruhr. Es gibt keinen Glauben an das Kreuz ohne Kampf gegen das Böse. Zugleich handelt es sich um einen Kampf der Liebe, nicht um Versuche, das Böse mit noch Böserem zu überwinden.
Sie betont, dass die Auferstehung die Möglichkeit eines neuen moralischen Vorstellungsvermögens eröffnet, das die bestehenden rassistischen Strukturen herausfordert und eine gerechtere Zukunft für Schwarze Menschen fördert.
Aber wo zeigt sich ihre verwandelnde Kraft? Ihr Sohn hatte ihren Glauben herausgefordert angesichts des Mordes an George Floyd. Drohte die Brutalität der Mächtigen und der Zynismus der Unbeteiligten unseren Glauben auszulöschen? Kelly Brown Douglas merkte an sich selbst: Sie kann auch die bestgemeinten «thoughts and prayers» wohlmeinender Weisser nicht mehr ertragen.
Und dann kam es zu einer Bewegung der Empörten. Es waren nicht nur Schwarze, die auf die Strasse gingen und demonstrierten. Black Lives Matter, das war ein Schrei der Trauer, der Empörung und des Widerstandes. Und dann wurde es noch mehr. Viele fanden ihre Sprache wieder und mehr: Ihre Phantasie für eine andere Gesellschaft.
Für manche Beobachter:innen war es verstörend zu hören, dass eine wichtigste Forderung vieler Demos «Defund the police» lautete. Abschaffung der Polizei – obwohl doch gerade ein Mord geschehen war? Ja, durch die Polizei. Und offenbar haben viele keinen Begriff davon, dass die meisten Schwarzen in den USA in Erfahrungen von Unrecht niemals die Polizei rufen würden. Weil sie keine Hilfe, sondern noch mehr Probleme befürchten.
Abschaffung dieser Polizei, endlich historische Gerechtigkeit, Reparationen für ein Unrecht vieler Generationen – so vieles wurde auf einmal sagbar. Und es fand tausendfaches Echo, auf vielen Strassen und das weltweit. Das Leid vieler Schwarzer und ihre Fähigkeit, die Vision einer besseren Gesellschaft auf die Strasse zu bringen, auf einmal konnten viele es sehen und hören, die an ihr Wegschauen zutiefst gewöhnt waren. Die Sehnsucht nach Black Lives Matter wurde eine neue, globale Realität.
Und sie merkte in dieser Situation: Für sie war das eine Wirkung bzw. ein Wirklich-Werden von Auferstehung. In 70 Ländern waren die Strassen voller Menschen. Etwas Neues ist entstanden. Nicht nur Worte, sondern ein Glaube, der sich in Hoffnung erweist, in Widerstand, der ist auch heute lebendig.
Wie kannst du an deinem Glauben noch festhalten, hatte ihr Sohn sie gefragt. Und sie erzählte ihm von ihrer Urgrossmutter, die als Sklavin geboren wurde und als Sklavin starb, ohne Chance auf Freiheit. Und die in ihrer Weise in ihrem christlichen Glauben die Kraft zu einer Hoffnung gefunden hat, dass diese Tyrannei enden wird. So vieles ist noch im Argen und zugleich hat sich manches geändert. Weil immer wieder Menschen in diesem Glauben an die Auferstehung eine Hoffnung finden, die die Welt erschüttert.
6. Glaube an die Auferweckung – ein Osterstrauss
Ostern ist keine Theorie. Ostern ist ein Handeln Gottes, in Jesus, aus Liebe für alle Menschen. Alle Versuche, den Inhalt zu erklären, alle Dogmen kommen nachträglich.
In seinem Essay zur Auferstehung schliesst Ingolf Dalferth an die urreformatorische und auch biblische Unterscheidung von Evangelium und Lehre an. Wo das Evangelium eine geistgewirkte Mitteilung von Gottes Liebe ist, da ist Lehre der nie endende menschliche Versuch, sich gedanklich Rechenschaft vom Glauben an dieses Evangelium zu geben.
«Dogmen legen das Evangelium aus und das Evangelium nicht die Dogmen.» (Dalferth 2023, 33)
Dieser Versuch ist wichtig, schon die biblischen Texte beginnen damit, den eigenen Glauben so gut es geht zu verantworten. Dogmen «sind nicht selbst die Wahrheit, auf die sich der Glaube richtet und an der sich das christliche Leben ausrichtet.» (Ebd.)
Wir haben uns die Vielfalt heutiger Deutungen der Auferstehung angeschaut. Jede/r wird etwas bemerkt haben, das fremd oder rätselhaft bleibt. Aber vielleicht auch etwas, das anspricht. Und genau dies, dass etwas einleuchtet, lässt sich nicht herstellen. Es passiert. Kein Wunsch oder Wille kann das erzwingen. Und es geschieht vielstimmig.
Was in einer Lebensphase Zugang zum Glauben ist, mag einem später verengt erscheinen. Es lässt sich nicht festhalten. Es fehlt nicht an Versuchen, diese Vielfalt der Zugänge zu ersetzen durch die eine, ultimative Klärung. Unsere, dogmatische Klärung. Es dürfte weiser sein, die Vielfalt zu ertragen, ja vielleicht zu umarmen als bunten Osterstrauss.
Literatur
Barth, Karl (71987): Dogmatik im Grundriss. Zürich: TVZ.
Barth, Ulrich (2021): Symbole des Christentums. Berliner Dogmatikvorlesung. Hg. Von Friedemann Steck. Tübingen: Mohr Siebeck.
Baumberger, Evelyne (2025): Die Frauen am Grab
Dalferth, Ingolf U. (2023): Auferweckung. Plädoyer für ein anderes Paradigma der Christologie. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt.
Douglas, Kelly Brown (2021):Resurrection Hope: A Future Where Black Lives Matter, Maryknoll: Orbis.
Danz, Christian (2013): Grundprobleme der Christologie. Tübingen: Mohr Siebeck.
Moltmann, Jürgen (1989): der Weg Jesu Christi. Christologie in messianischen Dimensionen. München: Chr. Kaiser.
Pannenberg, Wolfhart (51990): Das Glaubensbekenntnis. Ausgelegt und verantwortet vor den Fragen der Gegenwart. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.
Slenczka, Notger (2014): Die Christologie als Reflex des frommen Selbstbewusstseins. In: Jens Schröter (Hg.): Jesus Christus. Tübingen: Mohr Siebeck, 181-241.
Sölle, Dorothee (1980): Wählt das Leben. Stuttgart: Kreuz Verlag.