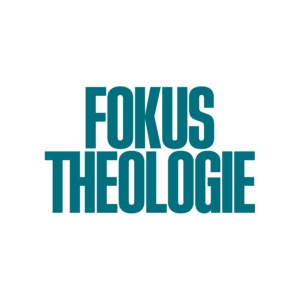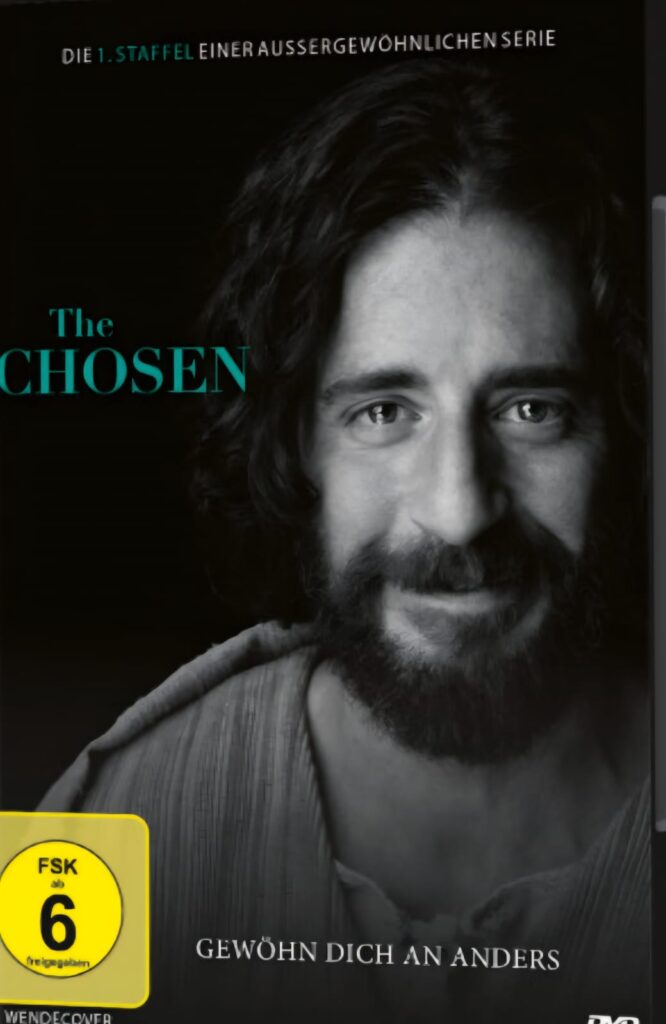1. Einleitung
Seit Jahren sorgt die Jesus-Serie The Chosen für Furore. Wenn die Zugriffszahlen sich weiter so entwickeln wie bisher, wird sie spätestens im nächsten Jahr von über einer Milliarde Menschen gesehen worden sein. The Chosen hat viele begeisterte Fans; aber auch entschiedene Kritiker:innen. The Chosen polarisiert. Angesichts der Reichweite dieses Projekts sollte man es in Kirche und Theologie nicht ignorieren, sondern die Argumente kennen, die für oder gegen The Chosen ins Feld geführt werden. Denn eins ist sicher: The Chosen prägt gegenwärtig die persönliche Vorstellung von Jesus von Nazareth von sehr viel mehr Menschen, als Bibellektüre oder Gottesdienstbesuche.
2. Basisinformationen
Zuerst ein kleiner Überblick für alle, die The Chosen noch nicht kennen. Massgeblicher Leiter des Projekts ist Dallas Jenkins. Jenkins stammt aus einer evangelikalen Familie, er ist der Sohn von Jerry B. Jenkins, dem Co-Autor von Left Behind, einer Endzeitserie mit über 70 Millionen verkauften Büchern.
Dallas Jenkins hat als Filmemacher in Hollywood begonnen, aber nach einer beruflichen und persönlichen Krise beschlossen, christliche Filme zu drehen, die vom Niveau her sich messen lassen wollen mit dem, was in Hollywood oder auf Netflix Standard ist. Zugleich wollte er inhaltlich keine Kompromisse eingehen, was seine eigene Glaubensprägung angeht.
In einem Interview sagt Dallas Jenkins über sich selbst:
„I’m a Bible-believing evangelical. I have zero desire to mess with Scripture or make some sort of new theological point. This is about telling these stories in a way that makes the moments in Scripture even more impactful.“
Daher wird The Chosen über Crowdfunding finanziert: Von Anfang an wollte man, dass Christinnen und Christen mit ihrem Spendengeld die Serie ermöglichen und tragen, so dass sie inhaltlich völlig unabhängig ist von den Erfolgszwängen des Film-Business.
In den Anfangsjahren haben viele die Verbindung zu den Angel Studios, kritisiert; Zum einen, weil Angel Studios einen mormonischen Hintergrund hat, zum anderen weil diese Filmfirma für viele Produktionen mit konservativ-kulturkämpferischer Ausrichtung bekannt ist. 2024 hat man sich getrennt, The Chosen ist nun selbstständig, getragen von Spendengeld und geleitet vom Loaves and Fishes Team um Dallas Jenkins.
The Chosen ist angelegt auf 7 Staffeln mit je 8 Folgen, die durchschnittlich 50 Minuten dauern. Für das Leben Jesu stehen so 50-60 Stunden zur Verfügung, sehr viel mehr als bei allen anderen Jesus-Filmen, die zwischen 90 und 210 Minuten Zeit hat. Was macht die Serie aus dieser Zeit?
Genretypisch nutzt sie die Möglichkeiten seriellen Erzählens. Sie baut lange Handlungsstränge auf, kreiert Spannungsmomente und kann Charakterentwicklungen Raum geben. Das gilt am wenigsten für Jesus, der sich von Anfang bis zum Ende treu bleibt. Es sind die Menschen um ihn herum, die im Fokus stehen. Der Titel The Chosen bezieht sich nicht in erster Linie auf Christus als den Erwählten, sondern auf die von ihm berufenen Menschen. Wir sehen, wie die engsten Jesusanhänger ihn jeweils entdecken, mit ihren biographischen und sozialen Besonderheiten. Und wir lernen Jesus jeweils aus ihrer Perspektive kennen.
3. Die Stärken der Serie
a) Diversität
Der Fokus auf die Nebenfiguren erlaubt es, die Welt von damals lebendig werden zu lassen, und das vielfältiger, als man es je gesehen hat. Gott sei Dank wurde das Projekt noch in den 2010er Jahren begonnen, in der guten alten Zeit vor der Dominanz des weissen christlichen Nationalismus, als Diversity noch ein weitgehend geteilter Wert in den USA war.
Die Schauspieler:innen verkörpern äusserlich ein breites mediterranes Spektrum, inklusive einiger PoC, auch im engeren Jüngerkreis. Die Jüngerin Tamar, eine Freundin von Maria Magdalena, ist schwarz. Jesus ist natürlich nicht blond.
Und es geht viel weiter. Wie Jesu Anhänger, so werden auch Juden und Römer divers präsentiert. Es gibt keine schablonenhafte und klischeehaften Darstellung wie so oft. Die biblischen Texte werden ernstgenommen: Das Judentum wird so vielfältig wie nie gezeigt. Das gilt auch für die Römer. Es gibt die Feinde und die Freunde. Und dazwischen befinden sich viele skeptische und schwankende Figuren. Das ist insgesamt richtig stark gelungen.
b) Jesus als Jude
Neu und positiv ist es, wie sehr die Jesusbewegung als jüdische Gemeinschaft sichtbar wird. Wir sehen im Laufe der Serie einen Durchgang durch den jüdischen Festkalender.
Immer wieder wird gezeigt, wie Jesus und die Seinen Schabbat feiern (erstmals Staffel 1/ Episode 2). Das Laubhüttenfest, sein Hintergrund und die liturgische Umsetzung kommt in Staffel 2 zum Zuge (S2/E4). Seine Antrittspredigt in Nazareth hält Jesus, weil er seine Mutter zum Neujahrsfest (Rosch ha-Schana) besuchen kommt (S3/E3). In dieser Staffel feiert man auch das Purimfest, im Hause des Zebedäus (S3/E7). Das Lichterfest Chanukka wird ausgiebig und für viele sicher sehr informativ gefeiert in der vierten Staffel (S4/E6) Dass Passahfest schliesslich bestimmt die meisten Folgen von Staffel 5, die ganz der letzten Woche Jesu in Jerusalem gewidmet ist.
Jesus und seine Jünger beten immer wieder Psalmen und andere jüdische Gebete.
Die Serie widersteht sehr konsequent allen früheren Versuchen, die Jüngergemeinschaft als quasi christliche Gruppierung zu zeichnen.
Historisch ist es für die Zeit Jesu alles andere als klar, wie die Feste konkret begangen wurden. Viele unserer Informationen stammen aus späterer Zeit. Die Serie hat sich dafür entschieden, so manchen Anachronismus auf sich zu nehmen; sie zeigt eine Reihe von jüdischen Formen, die erst aus rabbinischer Zeit bekannt sind (wie der freie Stuhl für Elia, das Dayenu Seder-Lied oder das Neujahrsfest in der Synagoge). Puristen mögen das beklagen. Aber das ist m.E. akzeptabel, so lässt sich auch mit wenig Wissen über die Zeit Jesu der jüdische Charakter gut sichtbar machen.
c) Jesus-Bewegung
In der Bibel ist Jesus kein Ein-Mann-Unternehmen. Er wurde von vielen Menschen unterstützt. Lukas nennt in Lk 8,1-3 ausdrücklich „einige Frauen“, namentlich Maria, Johanna und Susanna, und „viele andere, die ihn unterstützten mit dem, was sie besassen.“ (Lk 8,3)
In der späteren Tradition wurde ihr Gedächtnis kaum gepflegt. The Chosen macht diese Figuren ausdrücklich stark. Von der Jüngerschaft wird das Bild einer attraktiven Gemeinschaft gezeichnet. Am Ende ist das historisch höchst plausibel. Die meisten werden gesehen haben: Diese Gruppe ist einladend. Hier finde ich Zugehörigkeit, Geborgenheit und Unterstützung.
Besonders absurd ist eine oft vorgebrachte Kritik an der Serie, dass Jesus sich bei der Konzeption der Bergpredigt von Matthäus unterstützen lässt. Als ob der Sohn Gottes dabei Hilfe brauche, lautet der Vorwurf. Tatsächlich aber sind die grossen Reden Jesu keine historisch greifbaren Ereignisse, sondern Ergebnis der Redakteurtätigkeit des Matthäusevangeliums: Bergpredigt (5-7), Aussendungsrede (10), Gleichnisrede (13), Jüngerrede (18) und Endzeitrede (24-25).
Wenn die Serie zeigt, wie sich Jesus bei der Komposition der Bergpredigt von Matthäus helfen lässt, ist das eine höchst angemessene Fiktion.
d) Der menschliche Jesus
Von Anfang an wird in The Chosen die göttliche Natur Jesu stark betont. Das kann und muss man auch kritisch diskutieren. Aber die menschliche Seite kommt nicht zu kurz. Woran merkt man das?
- Jesus ist ein Mensch in Beziehungen. Er lebt eine sehr vertraute Beziehung zu seiner Mutter Maria, die in allen Staffeln ein Fixpunkt ist. Er hat viele Freundschaften. Mit seinen Jüngern, und auch mit einem erweiterten Kreis, z.B. mit Lazarus, Maria und Martha.
- Jesus zeigt seine Gefühle. Er lächelt und er lacht. Er weint und er wird wütend. Wir sehen Jesus feiern und spielen, singen und tanzen. Wir erleben ihn auch einsam und frustriert. Im Umgang mit Menschen ist Jesus sehr empathisch. Seine Zuwendung ist glaubhaft. Es wird vorstellbar, dass die Gegenwart dieses Menschen heilsam ist. Und wenn es sein muss, kann dieser Jesus auch wütend und laut werden. Um Gottes und der Menschen willen.
- Jesus ist humorvoll. Immer wieder macht Jesus Witze und bringt Menschen zum Lachen. Er lächelt verschmitzt, nimmt seine Gesprächspartner auf den Arm, entkrampft viele Begegnungen durch Ironie oder Übertreibung. Steht das in der Bibel? Nein, aber es wirkt gut und glaubhaft erfunden.
Dieser Jesus verkörpert in seiner Zuwendung zu den Menschen Gottes Liebe zu ihnen. Jesus ist ein Gleichnis Gottes. Mit Tit 3,4 gesprochen: Dieser Jesus wird gezeichnet als eine Erscheinung der „Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes». Dass dies dem Jesus-Darsteller Jonathan Roumie sehr charmant und gewinnend gelingt, macht für sehr viele Menschen wohl den grössten Reiz der Serie aus.
4. Kritisches
Es gibt bislang nur wenige wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit The Chosen, die die Serie an dem messen, was angesichts heutiger Bibelforschung möglich oder nötig wäre. Die Serie nimmt fachkundigen Rat punktuell in Anspruch, insgesamt aber ist sie in der Rezeption einer wissenschaftlichen Sicht auf Jesus – recht abstinent. Das ist bedauerlich und in mancherlei Hinsicht auch problematisch. Fassen wir einige schwierige Aspekte zusammen.
a) Gescheiterte Evangelien-Harmonie
Selbst bibeltreueste Entwürfe wie der Jesus-Film (1979) haben gemerkt, dass jede Darstellung der Evangelien vor einem Konzeptionsproblem stehen. Wie verfilmt man vier Evangelien? Alle Stoffe nacheinander und somit vielfach mehrfach zu zeigen, kommt offensichtlich in Frage. Muss man sich für eine Konzeption entscheiden? Oder lassen sie sich miteinander verzahnen?
Der Jesus-Film von Pasolini (1963) folgt konsequent dem Mattäusevangelium. Der Jesus-Film von Campus für Christus (1979) hat sich hingegen für das Lukasevangelium entschieden. Solche Filme haben den Vorteil einer klaren Gesamtkonzeption.
Die Macher von The Chosen glauben, dass sie die Stoffe der vier Evangelien miteinander verbinden können. Leitend war dabei zum einen sicher die Idee, so die für serielles Erzählen attraktivsten Stoffe auswählen zu können. Ganz sicher steht dahinter aber auch eine theologische Entscheidung, nämlich das Ziel, möglichst der gesamten Bibel gerecht werden zu wollen.
Gelingt dies? Nein, zumindest nicht so. Bei den Evangelien unterscheiden wir seit langem zwischen den drei Synoptikerm (Markus, Matthäus und Lukas) und dem Evangelium von Johannes. Bei Johannes hat Jesus eine Botschaft: Sich selbst. Er ist Weg, Wahrheit und Leben. Auferstehung, ja eins mit Gott. Nichts davon findet sich in dieser Zuspitzung bei den Synoptikern.
Bei den Synoptikern hat Jesus auch eine zentrale Botschaft: die vom Reich Gottes. Die Gottesherrschaft steht im Zentrum, in seinen Gleichnissen und in seinen ethischen Weisungen, auch in seinen Taten, vor allem den Heilungen und Exorzismen. Nichts davon findet sich so bei Johannes: Es gibt dort keine Reich-Gottes-Verkündigung und mehr: Johannes erzählt kein synoptisches Gleichnis und auch keinen einzigen Exorzismus.
Diese Konzeptionen lassen sich nicht so verbinden, dass beides bewahrt bleibt. Bildhaft erklärt:
Es gibt vegetarische und fleischhaltige Gerichte. Wenn man sie vermischt, dann hat man keine Mischung, sondern ein fleischhaltiges Gericht.
Es gibt Cocktails und alkoholfreie Cocktails. Wenn man sie zusammenschüttet – hat man einen alkoholhaltigen und keinen alkoholfreien Cocktail.
Das Johannesevangelium ist wie Fleisch und Alkohol: Wenn es drin ist, ist die Alternative raus. The Chosen folgt letztlich entschieden dem johanneischen Aufbau. Es ist von Anfang an klar, dass Jesus der Messias, das Lamm Gottes und der Erlöser ist, der Sohn Gottes, der vom Vater auf die Erde gesandt wurde. Die Stoffe von Nikodemus und der Frau am Jakobsbrunnen (Joh 3 und 4) kommen schon in der ersten Staffel vor. Jesus offenbart sich von Anfang an seinen Jüngern und auch ausgewählten anderen als Messias, Sohn Gottes und Erlöser.
Es gibt weder in seiner Botschaft noch in der Jesuserkenntnis der Jünger nennenswerte Entwicklungen. Wer er ist, wissen alle von Anfang an. Dass alles auf Tod und Auferstehung hinausläuft, bleibt für alle (wie in allen vier Evangelien) von Anfang bis Ende unverstanden.
Der Geheimnisvolle seiner Person und seiner Sendung, die bei den Synoptikern so wichtig ist, spielt keine grosse Rolle
b) Verlust der Reich-Gottes-Botschaft
Alle theologischen Strömungen heutiger Exegese sind sich einig, dass die öffentliche Botschaft Jesu die Verkündigung vom Reich Gottes war, so wie es alle drei Synoptiker ausführlich zeigen.
The Chosen bemüht sich, ansatzweise die Verkündigung vom kommenden und schon anbrechenden Reich einzufügen. Einzelne Gleichnisse werden erzählt, Wundertaten gewirkt. Die Pointe aber ist immer die johanneische. Das Gericht Gottes kommt, doch wer an Jesus glaubt, wird gerettet. Bei jedem synoptischen Thema wird über kurz oder lang johanneisch abgeschlossen.
Letztlich geht es immer um die Sendung Jesu, als Messias und Gottessohn, der gekommen ist, sein Leben für die Menschen zu geben zur Vergebung der Sünde.
Die prophetische, soziale Botschaft kommt so gut wie gar nicht vor. Deutlich wird das bei seiner Antrittspredigt in Nazareth zum Neujahrsfest (S3E3). Wie bei Lukas (Lk 4,16-21) zitiert Jesus Jes 61 mit Bezügen zu Jes 58. In den alttestamentlichen Zitaten ist die soziale Botschaft der Propheten des ATs verdichtet. Diese soziale Botschaft ist bei Jesus verbunden mit seiner Hoffnung auf ihre baldige Erfüllung durch Gott, die jetzt schon beginnt.
In The Chosen finden die sozialen Seiten dieser Botschaft keine Vertiefung. Entscheidend ist die Provokation: Die Menschen von Nazareth haben keine Hoffnung, so lange sie sich nicht als Sünder erkennen und an Jesus glauben.
c) Authentizitätsfiktion
Evangelikale Bibelexegese ist sehr stark von einer apologetischen Grundhaltung geprägt. Grundlegend ist das Ziel, alle Erzähltexte der Bibel als tatsächlich so geschehen zu plausibilisieren. Dieser apologetische Unterton durchzieht auch The Chosen.
Von der ersten Staffel an macht die Serie deutlich: Alles, was Jesus sagte und tat, wurde nicht nur von vielen Zeugen wahrgenommen. Zwei Menschen haben von Anfang an mitgeschrieben: der Zöllner Matthäus und der Sohn des Zebedäus Johannes. Es wird nicht nur in den Begebenheiten immer wieder gezeigt, dass beide ihren Stift zücken und mitschreiben. Es wird auch in Ausblicken vertieft.
Einmal sieht man den alt gewordenen Johannes, wie er mit Maria, der Mutter Jesu die Konzeption seines Evangeliums bespricht. Ein anderes Mal sieht man den alt gewordenen Matthäus, wie er Maria von Magdalena besucht, um ihr sein fertiggestelltes Matthäusevangelium als erster zur Lektüre zu geben.
Die setzt die Evangelientexte nicht nur in Szene. Sie fügt immer die Botschaft hinzu: Die hier erzählten Ereignisse sind bestens bezeugt. Alles ist wirklich so passiert und gesagt worden.
Diese Authentizitätsfiktion scheitert an mehreren Dingen. Das erste Problem ist, dass diese Annahme, dass zwei Evangelien auf direkte Augenzeugenberichte zurückgehen, überhaupt nicht Teil der Bibel ist. Kein Mensch würde nach Lektüre des Matthäusevangeliums auf die Idee kommen, dass der Zöllner Matthäus in Mt 8 der Autor des Ganzen sein könnte. Komplizierter ist die Lage im Johannesevangelium. Aber auch hier bleibt der eigentliche Autor des Evangeliums letztlich ungenannt.
Es sind altkirchliche Traditionen, die die Echtheit der Evangelien durch solche Abfassungsannahmen stützen wollten. Aus historischer Perspektive sind diese Legenden keineswegs gut bezeugt. Sie sind genauso fraglich wie viele gleichzeitig entstandenen Legendenstoffe etwa zum Vorleben der Familie der Mutter Gottes Maria.
Vor allem aber können diese Theorien überhaupt nicht erklären, wie die Diskrepanz der johanneischen und der synoptischen Stoffe zustande kommt. Matthäus ist stets dabei, wenn Jesus von sich selbst als Weg und Wahrheit, als Auferstehung und Leben erzählt, der eins mit dem Vater ist. Er sieht es mit eigenen Augen, wie Jesus einen blindgeborenen das Augenlicht schenkt und Lazarus drei Tage nach seinem Tod aus dem Grab ruft, als bei diesem schon der Verwesungsprozess eingesetzt hat.
Und diese dramatischen Begebenheiten soll Matthäus als nicht so wichtig empfunden haben? Nach der Darstellung des Johannes und der Serie ist die Auferweckung des Lazarus das entscheidende Ereignis, dass zur Eskalation der Feindschaft beitrug. Und alle anderen Evangelien haben dies als etwas eingestuft, was man auch weglassen kann?
Das gilt auch für die direkte Selbstverkündigung Jesu. Wenn dies von Anfang an Teil seines öffentlichen Wirkens war, wie kommt dann eine Sequenz wie die von den Emmausjüngern im Lukasevangelium zustande? Dort erfährt der Auferstandene von Jüngern aus dem engeren Kreis, dass sie zu Jesus von Nazareth gehörten, „der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, 20 und wie unsere Hohen Priester und führenden Männer ihn ausgeliefert haben, damit er zum Tod verurteilt würde, und wie sie ihn gekreuzigt haben. 21 Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde“
Historisch dürfte das ziemlich genau wiedergeben, was viele Anhänger:innen vor Jesu Tod gedacht haben. Wie passt das dazu, dass von Anfang an in der öffentlichen Verkündigung und erst recht in der internen Jüngerbelehrung die Gottheit Jesu das Thema ist?
Es gibt keine historisch plausible Erklärung für diesen Befund. Es gibt den sehr grossen Konsens der Bibelwissenschaft, dass das Johannesevangelium mit seiner Botschaft nicht die historische Botschaft Jesu wiedergibt, sondern eine daran anschliessende theologische Vertiefung bietet.
Die Evangelien sind so unterschiedlich und so traditionsabhängig, dass an unabhängige Augenzeugenberichte nicht zu denken ist; zumindest nicht nach allem, was man sich heute darunter vorstellt. Bibeltreue ist in diesem Fall kein Massstab, sondern eine Ideologie. Man sucht eine Sicherheit, die schlicht nicht gegeben ist.
d) Das Bild der sündigen Frau
Für den evangelikalen Hintergrund der Serie ist The Chosen geradezu feministisch. Die weitgehende Ignoranz gegenüber historisch-kritischer Bibelwissenschaft führt aber zu Problemen, die vermeidbar gewesen wären.
Maria Magdalena ist eine Schlüsselfigur der Serie. Im Vergleich zu vielen früheren Verfilmungen wird ihre starke Stellung in der Jüngergemeinschaft (und nicht nur die enge Beziehung zu Jesus) sichtbarer als je zuvor. Umso problematischer ist die Verhaftung an traditionelle Vorstellungen.
Im Neuen Testament wird über sie lediglich gesagt, dass Jesus sie von Dämonen befreit habe (Lk 8,2; Mt 16,9). In der kirchlichen Tradition, vor allem seit Gregor I., wird sie dann mit der Sünderin aus Lk 7 identifiziert, d.h., als ehemalige Prostituierte gekennzeichnet. Inzwischen ist vielfach aufgearbeitet worden, dass diese Zurückdrängung einer starken Frau in der Tradition ein Beispiel christlicher Misogynie ist.
Wie geht The Chosen mit ihrer Vergangenheit um? Mindestens fahrlässig. Entgegen manch umlaufender Verkürzungen ist es nicht so, dass sie als Prostituierte gezeigt oder bezeichnet wird. Ihre Besessenheit steht im Zentrum, verbunden mit einem verzweifelten Leben mit Alkohol, Bars – und eben auch Männerbeziehungen, die nicht näher thematisiert werden. Promiskuität wird angedeutet – und so bleibt die Serie unnötigerweise immer noch einer Tradition verhaftet, die verfälschend war und biblisch unnötig ist.
Problematisch ist auch, dass sie in dieser Lebensphase als „Lilith“ bezeichnet wird und sich auch selbst so versteht. Im Zentrum der Maria-Story von The Chosen steht die Logik: Jesus ruft sie bei ihrem Namen Maria und befreit sie so von ihrer falschen Lilith-Identität.
Wofür steht der Name Lilith? In der Bibel kommt der Name nur einmal vor, als Bezeichnung eines Wüstendämons (Jes 34,14). Als Dämonenbezeichnung war der Name im alten Orient gängig. Zur Wirkungsgeschichte gehören spekulative Ausdeutungen im Mittelalter: Lilith wird hier zur ersten Frau Adams. Anders als Eva wurde sie ebenfalls aus Erde geschaffen, wie ihr Mann Adam. Daher weigerte sie sich auch, sich ihm unterzuordnen. Zur Strafe wird sie verflucht und wird ein weiblicher Dämon der Zerstörung und Verführung.
Offensichtlich wird so die Idee von Gleichberechtigung als sündiger Aufruhr dargestellt. In der feministischen Forschung gilt die Lilith-Legende als Musterbeispiel einer patriarchalen und frauenfeindlichen Geschichte.
Möchte The Chosen ernsthaft diese symbolischen Hintergründe verstärken? Oder ist das einfach Ahnungslosigkeit? So oder so, die promiskuitive Lilith im Vorleben Marias ist mindestens – eine sehr schlechte Erfindung.
Und doch gibt es in The Chosen ein unglaublich progressives Easteregg: In S4/E7 wird gezeigt, wie der alte Matthäus die alte Maria besucht. Sein Evangelium ist fertig und er bittet sie, es zuerst zu lesen. Maria sagt zu und noch mehr: Auch sie hat einige Erinnerungen an Jesus aufgeschrieben. Und Matthäus ist bereit, sie zu lesen.
Ein Evangelium der Maria? In der Tat, zumindest in kleinen Auszügen ist ein solcher Text erhalten. Nun kann man historisch ausschliessen, dass es sich um ein Werk der Maria von Magdala handelt (wie auch das Matthäusevangelium nicht von einem Zöllner und Mitglied der Zwölf stammt), es ist eine Schrift, die aus den Anfängen des Gnostizismus in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts stammt.
Die Gnosis gilt in der alten Kirche als Irrlehre und es gibt gute Gründe dafür. Man muss dazu auch wissen: Diese Bewegung lehnte die damals entstehende bischöfliche Ordnung und Hierarchie ab. Sie übte Kritik an der Überhöhung des Petrus und tritt für einen eigenständigen Zugang vieler Menschen zu Jesus ein, wie bei Maria, die Jesus näher stand als die meisten männlichen Anhänger.
Ist das historisch? Im Detail sicher nicht. Aber es gibt eine ziemliche Wahrscheinlichkeit, dass sich in solchen gnostischen Texten eine Erinnerung an echte Geschichte verbirgt: Dass die Frauen in der Jesusbewegung eine deutlich wichtigere Stellung hatten, als die Kirche ihnen spätestens seit dem 2. Jahrhundert zugestehen wollte. Dass The Chosen Raum hat für solche Hinweise, das ist mehr, als man von einer evangelikalen Serie erwarten konnte. Dass sie am Ende viele Frauenrollen doch ziemlich stark auf eine helfende, dienende, unterstützende Rolle reduziert – ist bedauerlich.
Vgl. auch den Beitrag: The Chosen und seine Vorläufer.
Vgl. auch die 61 Folge von Geist.Zeit: The Chosen – Welches Jesusbild vermittelt die Serie?
Der Beitrag ist Teil des Jesus-Dossier von Fokus Theologie.