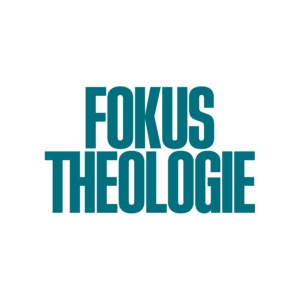Dieser Beitrag ist Teil unseres Dossiers Was ist Spiritualität? Praxis. Am Beitragsende finden sich weiterführende Informationen und Links.
Der Autor und Referent William Paul Young ist einer der meistgelesenen christlichen Schriftsteller unserer Zeit. Er kommt im Herbst 2025 auf eine Vortagsreise nach Europa und wird u.a. in Zürich am 21. und 22. September oder auf dem Spirit Kongress in Bochum reden. Was ist das Geheimnis seines Erfolges?
1. Der unwahrscheinliche Bestsellerautor
William Paul Young wurde 1955 in Kanada geboren und verbrachte einen Teil seiner Kindheit als Sohn seiner als Missionare tätigen Eltern in Niederländisch-Neuguinea (heute Indonesien). Seine Kindheit und Jugend waren von kultureller Fremdheit, Missbrauchserfahrungen und religiöser Enge geprägt – ein Hintergrund, der seine späteren Themen tief geprägt hat. Nach Jahren in verschiedenen Berufen begann er erst spät mit dem Schreiben, zuerst vor allem für seine eigenen Kinder, denen er an seinen Gedanken zu Gott und Mensch Anteil geben wollte. Doch seine Bücher wurden weltweite Bestseller und fanden bei Menschen weit über die Grenzen der Kirchen hinaus grosse Resonanz.
Sein erster Roman «Die Hütte» erzählt die Geschichte eines Vaters, der sein Kind in einer furchtbaren Gewalttat verliert und am Glauben verzweifelt – bis er Gott noch einmal ganz neu entdeckt. In «Der Weg» lernen wir einen Mann kennen, der nach schweren Schuldverstrickungen eine zweite Chance bekommt. Und diese ganz anders nutzt, als man erwarten würde. «Eva» widmet sich der Frage nach Ursprung und Würde des Menschen – und dem Verhältnis der Geschlechter. In «Lügen, die wir uns über Gott erzählen» fasst Young seine theologischen Überzeugungen direkter zusammen und korrigiert populäre, aber zerstörerische Gottesbilder.
Es gibt nur wenige Menschen, die christliche Bücher für ein solches Millionenpublikum veröffentlicht haben. Allein sein Bestseller «Die Hütte» ist über 23 Millionen Mal verkauft worden.
Vor allem im (später auch verfilmten Buch) «Die Hütte», aber auch in den beiden Büchern «Der Weg» und «Eva» knüpft Young an die hohe Kunst der Vermittlung christlicher Einsichten mit dem Medium von Romanen an. Dabei muss man sich nicht lange darüber streiten, ob es sich hier um Literatur im bildungsbürgerlichen Sinn handeln soll (soll es nicht); die Romanhandlung, die Figurenzeichnung, all das dient der Vermittlung zentraler christlicher Einsichten. So haben es C.S. Lewis und George Macdonald gehalten, die Young als Vorbilder immer wieder benennt. Darüber hinaus könnte man die Pilgerreise von John Bunyan nennen und wohl auch Dantes Göttliche Komödie. Was ist seine Botschaft?
2. Gott ist Liebe
In seinen Büchern geht es nicht nur um Gott. Vor allem in «Die Hütte» und in «Der Weg» kommt Gott nicht nur vor, sondern auch ausführlich zu Wort. Und ebenso lassen sich die anderen zentralen Romanfiguren ausführlich auf Gespräche mit Gott ein. Und sie zögern nicht, Gott ihrerseits in Frage zu stellen. Das ist für europäische Gemüter mindestens ungewöhnlich. Man muss sich klar machen, wo Young herkommt: «Die Welt, in der ich aufwuchs, legte keinen grossen Wert auf Fragen. (…) Wer immer unserer Theologie, Wissenschaft oder auch nur unserer Meinung widersprach, galt als Feind» (Young 2017, 10).
In seinen Büchern ist es anders. Menschen kritisieren Gott. Sie stellen heftige Fragen, äussern Zweifel, machen ihrer Enttäuschung Luft. Und die Gespräche gehen weiter. Es ist Youngs Lebensentdeckung, dass Gott so ist: Gesprächsfreudig. Dialogfähig. Ein «Dialog sollte niemals ein Mittel sein, das Gegenüber zu beherrschen oder mit Gewissheit zu überhäufen, sondern jenen Respekt zu bezeigen, der dem Wesen der Beziehung entspricht.» (Young 2017, 13)
Gott ist Beziehung. Dieser Gedanke wird wieder und wieder entfaltet. Gott ist in sich Beziehung – ein dreifaltiger Tanz der ewigen Begegnung. Und Gott ist zur Welt und zum Menschen immer schon in Beziehung. Oder ganz kurz: Gott ist Liebe. So weit so unspektakulär, möchte man meinen. Sagen das nicht alle christlichen Gruppen? Es kommt darauf an. Young schreibt:
«In jener religiösen Subkultur, wo ich aufwuchs, wussten wir alle, dass Gott Liebe ist. Wir sagten und sangen es die ganze Zeit» (Young 2017, 18). Vielleicht kann man so sagen:
Gott liebt uns alle! Das war immer richtig und selten wahr. Denn die Liebe Gottes gab es selten oder nie ohne aber.
In seinem Herkunftsmilieu war die Liebe Gottes immer eine bedingte Liebe. Gott liebt Dich, wenn Du… Dich bekehrst, ihm gehorchst, richtig glaubst etc. Wenn nicht, wird er dich richten, ja schlimmer, er wird dich für immer hassen und Dir ewige Qualen zufügen. Obwohl die Liebe Gottes als bedingungslos bezeichnet wurde, war sie das faktisch nie. Tatsächlich gab es zu jedem Zeitpunkt ziemlich viele Möglichkeiten, aus der Liebe Gottes herauszufallen.
Das ist nicht das biblische Gottesbild. Gott liebt von Anfang an bedingungslos. Die Erlösung am Kreuz ist die ultimative Verwirklichung dieser Liebe.
Die Liebe Gottes ist kein Angebot. Sie ist eine Realität.
Young hält sich hier strikt an die Bibel: Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst (2Kor 5,19). In seiner früheren Prägung wurden solche biblischen Aussagen abgeschwächt, wenn nicht verfälscht. Sie wurden immer wieder eingeklammert in ein Bedingungsgefüge, an dessen Ende klar war: Gott liebt nur diejenigen, die bekehrt sind, gehorsam, treu. Für alle anderen ist Gottes Liebe ein Angebot, keine Realität.
Eine solche Theologie der radikalen Liebe ist nicht neu. Sie zieht sich durch die Kirchengeschichte. In jüngerer Zeit war es im angelsächsischen Sprachraum z.B. der schottische Theologe Thomas F. Torrance, der gegen ein verengtes Verständnis von Gottes trinitarischer Liebe die darin erschlossene unwiderrufliche Gnade gross machte. Vorher hatte schon der Schweizer Theologe Karl Barth für eine Neuentdeckung der umfassende Liebe Gottes in seiner Gnadenwahl plädiert. Für Young spielt auch der ebenfalls von Barth beeinflusste Theologe Jürgen Moltmann eine anregende Rolle, gerade in der Verbindung mit einem trinitarischen Verständnis von Gott.
Können Barth, Torrance und Moltmann – alle drei natürlich noch einmal viel systematischer denkende Theologen – als Einflüsse genannt werden, so ist Young auch von seinen literarischen Vorbildern, dem schottischen Dichtertheologen George MacDonald und dem nordirischen bzw. britischen Apologet C.S. Lewis geprägt. Bei beiden (vor allem bei MacDonald) ist es der Gedanke, dass Gott Liebe ist, der entscheidend ist.
Kritiker werfen ihm vor, dass ein solches Bild von Gott die anderen Seiten Gottes, Heiligkeit, Gerechtigkeit und Zorn unterschlage. Ist das so? Nein, biblisch-theologisch ist das abwegig. Kritiker tun so, als wäre die theologische Betonung der Liebe eine Art liberale Einseitigkeit, als wäre Gott zwar Liebe, aber auch etwas anderes. Biblisch ist das keineswegs. Biblisch ist: Gott ist Licht. In ihm ist keine Finsternis (1Joh 1,5). Man kann nicht zu liebevoll von Gott denken.
Viel Kritik fand seine Entscheidung, Gott in «Die Hütte» als schwarze Frau erscheinen zu lassen.
Young hatte für solche Vorbehalte durchaus Verständnis. Er erzählt, wie seine eigene Mutter, die ihr Leben als evangelikale Missionarin an der Seite ihres Mannes in Indonesien verbracht hatte, erhebliche Schwierigkeiten damit hatte. Die Geschichte, wie sie damit ihren Frieden fand, ist schön und zum Nacherzählen zu lang (Young 2017, 51-58).
Die Quintessenz ist einfach. Gott ist natürlich weder Frau noch Mann. So steht es in der Bibel (Hos 11,9). Warum war es für Young wichtig, mit diesem Bild einen neuen Zugang zu Gott zu finden und anderen anzubieten? Weil er von Männern so viel Böses erlitten hatte.
Einem männlichen Gott hätte er sich niemals öffnen können. Und es gehört zu den Pointen seines Gottesbildes, dass Gottes Liebe sehr geschmeidig mit menschlichen Bedürfnissen umgehen kann.
3. Menschen sind nicht böse
Gehört es nicht zu den kirchlichen Lehren, dass alle Sünder sind? Nun liegt Young ein naives Bild vom Menschen fern. Seine Bücher handeln von Vergewaltigung und Mord, von Lüge und Verrat, Menschenhandel und Betrug. Offensichtlich hält Young Menschen nicht für durch und durch gut, natürlich tun Menschen Böses.
Zutiefst problematisch ist, was aus diesem Wissen um das Böse in der Christentumsgeschichte bisweilen gemacht wurde.
Vielen Gläubigen wurde die Überzeugung vermittelt: Ich bin böse. Ich bin nichts wert. Gott liebt mich trotzdem, oder besser: TROTZDEM. Nur deshalb habe ich Wert.
Gegen ein solches Menschenbild protestiert Young entschieden.
Der Glaube an eine solche Trotzdem-Liebe ist für Menschen in dieser Welt immer wieder ein Trost. Kurzfristig. Er hält nicht. Der Alltag stürzt immer wieder zurück in die Erkenntnis der eigenen Wertlosigkeit. Das ist nicht nur verheerend. Es stimmt auch einfach nicht. Vielmehr müssen viele neu verstehen:
«In Wahrheit haben wir deshalb einen inneren Wert, weil wir nach dem Bilde Gottes geschaffen sind.» (Young 2017, 24)
Young lehnt es ab, mit Teilen der christlichen Tradition diesen Befund einfach so zu deuten, dass Menschen in erster Linie wesentlich böse sind; und darum Böses tun. Ein solches Verständnis von Erbsünde verfehlt die Logik der Urgeschichte. Oft wurden die ersten Kapitel so gedeutet, als würde die menschliche Sünde den Segen Gottes aus Gen 1 und die dem Menschen zugesprochene Güte zunichte machen.
Mit Recht hat die moderne Exegese gezeigt, dass das Alte Testament keine Erbsünde in einem solchen Sinne kennt. Im Judentum gibt es eine solche Sicht bis heute nicht. Der Glanz des Anfangs wird getrübt. Böses bricht ein. Aber die ursprüngliche Güte der Schöpfung wird nie widerrufen oder ausgelöscht.
Gibt es denn dann so etwas wie Sünde noch? Aber natürlich. Wie im modernen Protestantismus üblich, versteht Young sie als Beziehungslosigkeit. «Wenn Gottes Wesen in der Beziehung besteht, muss die Sünde definiert werden und verstanden werden als eine Verfehlung der relationalen Wirklichkeit, als eine Verzerrung von Gottes Bild in uns.» (Young 2017, 179) Ist dann alles egal? Keineswegs. Alle Menschen sind verantwortlich, einander zu helfen – und sich nicht gegenseitig zu bekämpfen.
Das gilt nicht zuletzt auch für christliche Gruppen, die immer wieder gefährdet sind, im Kampf für ihre eignen Werte Gottes Herrschaft mit den eigenen Machtansprüchen zu verwechseln. Young betont deutlich und leider heute aktueller denn je:
«Wir müssen aufhören, Nationalismus und Patriotismus mit dem Königreich Gottes zu verwechseln und Jesus, den leidenden Diener, in den ‘Christus’ eines politischen Systems zu verwandeln, zumal was den kolonialistischen Imperialismus des Westens betrifft.» (Young 2017, 80).
4. Hoffnung für alle
Young hat selbst erlebt, wie man aus einer Religion der absoluten Gnade gnadenlose Konsequenzen ableiten kann. Denn es lässt sich sehr viel Schrecken produzieren aus der Frage, ob Menschen auch vollständig und ehrlich genug Gottes Gnade angenommen haben.
Die Bibel ist voller Aussagen, die dieses Schema radikal in Frage stellen: Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst (2Kor 5,19), heisst es bei Paulus. Christus ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein für unsere, sondern für die der ganzen Welt, schreibt Johannes (1Joh, 2,2). Denn in Christus wird alles erlöst, im Himmel und auf Erden, liest man im Kolosserbrief (Kol 1,20).
Was sollen wir machen mit diesen Aussagen? Einfach ignorieren, weil wir an das Spiel der bedingten Bedingungslosigkeit zu gewöhnt sind? Nein, so Young, lasst uns bei diesen Worten die Bibel ganz und gar wörtlich nehmen.
Was Gott in Christus tut, gilt allen. «Jeder Mensch, der je gezeugt wurde, fand Aufnahme in Tod, Bestattung, Auferstehung und Himmelfahrt.» (Young 2017, 94)
Gibt es keine Hölle? Doch, so Young, den Schmerz der Trennung von Gott, das ist sehr real. Aber dieser Schmerz wird nicht ewig sein (Young 2017, 107). Ja, es gibt Hoffnung für alle; eine Einsicht, die in der neueren Theologie immer stärker betont wird.
5. Theologische Geschichten der grossen Heilung
Für was für eine Theologie steht der Autor William Paul Young? Er verkörpert eine Theologie, die alle zur Verzweiflung bringt, die klare Schubladen brauchen. Ein Evangelikaler? Auch wenn er bis heute in offenen evangelikalen Kreisen positiv rezipiert wird, distanziert er sich doch deutlich zumindest von von vor allem fundamentalistisch-evangelikalen Ideen. Ein Liberaler? Dafür ist er mit seiner Betonung der Dreieinigkeitslehre, der Menschwerdung Jesu und seiner Auferweckung viel zu orthodox. Ist er ein Progressiver? Er hat sich an einigen Stellen deutlich anregen lassen, aber letztlich ist eine bibeltheologische Botschaft für den Einzelnen zentraler als eine befreiungstheologische Perspektive.
Im Spektrum deutschsprachiger Theologie ist Youngs Ansatz eine erfrischende Mischung biblisch-konservativer und emanzipatorisch-progressiver Einsichten. Konservativ im besten Sinne sind seine trinitarischen Gottesgedanken und die starke Betonung der Menschwerdung Jesu. Zeitgenössisch ist vor allem die Weise, wie es ihm gelingt, die biblische Botschaft mit Lebensfragen vieler Zeitgenoss:innen zu verknüpfen: Erfahrung von Leiden und der Warumfrage, Selbstzweifel, Auseinandersetzung mit Selbstwertfragen oder der Sehnsucht nach Anerkennung und Gemeinschaft.
Am Ende geht es ihm in all seinen Geschichten und Gedanken um Heilung. Er schreibt für Menschen, die in der Apotheke der biblischen Erzählungen Salben sucht, Heilkräuter und Gehhilfen, Medikamente gegen Selbstzweifel, Infusionen der Geborgenheit, Heil- und Stützverbände in den Stürmen ihres Lebens. William Paul Young kann in der Betonung dieser heilenden Kraft sehr einseitig werden. So einseitig, wie es gerade diejenigen benötigen, die durch ihre bisherige Erfahrung mit dem christlichen Glauben eher abgeschreckt als angezogen worden sind. Das ist nicht das ganze Christentum. Aber eines, das viele dringend brauchen und etliche bei ihm schon gefunden haben.
Literatur
Young, William Paul (2009): Die Hütte. Ein Wochenende mit Gott. Berlin: Allegria.
Young, William Paul (2017): Lügen, die wir uns über Gott erzählen. Berlin: Allegria.
Young, William Paul (2016): Eva. Wie alles begann. Berlin: Allegria.
Young, William Paul (2012): Der Weg. Wenn Gott Dir eine zweite Chance gibt. Berlin: Allegria.
Kruger, C. Baxter (2012): Wie wir Gott begegnen. «Die Hütte» und das neue Bild von Gott. Berlin: Allegria.